Ich weiß, ich war's - Christoph Schlingensiefs posthume Autobiographie
Kein Eis, kein Mond
von Christian Rakow
Berlin, Oktober 2012. Mit 16 Jahren dreht dieser wild gewordene Apothekersohn aus Oberhausen einen Super-8-Film, der ihm die erste kolossale Abfuhr seines Künstlerlebens einbringt: "Ich weiß nur eins, wenn ich den Film sehe: Du wirst in deinem Leben niemals einen Menschen lieben können. Denn du hast dich nicht für die Personen interessiert", sagt ein Redakteur beim WDR über das Jugendwerk, das wohl ein furioser Quark voll manischem Kunstwillen und Schrillpfeiferpoesie gewesen sein muss, also quasi schon damals ein echter Schlingensief.
Jetzt veitstänzelt das alles in buntesten Farben vor unserem inneren Auge, wenn man Schlingensief davon erzählen hört: "Der Film ist eine Komödie, heißt 'Mami, wir drehn 'nen Film' und handelt von einem Mann, der mit seiner Familie einen Film dreht. Die Dreharbeiten laufen komplett schief, ein totales Desaster, am Ende während der Kinovorstellung explodiert das ganze Haus und die Oma sitzt im Rollstuhl und sagt: 'Hans, Hans, du musst aber auch immer alles übertreiben.' Das ist der letzte Satz des Films."
Der letzte Satz des Films ist der erste des Werkes von Christoph Schlingensief. Er hat seine Fans (sein Publikum kann man wohl kaum sagen) in filmischen und theatralen Exzessen aus dem bundesdeutschen Familienbiedermeier in den bewusstseinserweiternden Spielwitz geführt. Er hat den Sprengstoff gezündet und den Knallfrosch. Und wenn man ihm Egozentrik vorwerfen mochte, wie der WDR-Redakteur seinerzeit, dann war er immerhin ein liebenswerter Egozentriker, einer, der Teams formte und mit seinen Akteuren aus Berliner Nervenheilanstalten über ein Jahrzehnt hinweg höchst eigene Formen sozialer und politischer Kunst schuf (siehe den Redaktionsblog zum Tod von Achim von Paczensky).
Wunderbar sprunghaft
Zwei Jahre liegt der Tod von Christoph Schlingensief nun zurück. Mit seinem Tagebuch einer Krebserkrankung "So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!" von 2009 war der damals 48-Jährige zum Bestsellerautor und Nationalkünstler avanciert (bis hin zum Auftritt in der ARD-Reihe "Deutschland, deine Künstler"). Bei der Biennale in Venedig 2011 wurde sein Oeuvre posthum mit dem Goldenen Löwen gewürdigt. Und jetzt folgt also die große staatstragende Autobiographie? Nein, mitnichten. "Ich weiß, ich war's", herausgegeben von Schlingensiefs Witwe Aino Laberenz, ist ein wunderbar sprunghafter, assoziativer, klarsichtiger, oft irrsinnig komischer Streifzug durch das eigene Leben und Werk.
 Laberenz hat Schlingensiefs Tonbänder und Mitschnitte seiner Lese-Auftritte während des letzten Lebensjahres zu einem Text komponiert, der ohne chronologische Ordnung Rückschau mit Reflexion verbindet, kurze Einwürfe zum Krankheitsverlauf neben Ideen für kommende Werke stellt. Herrliche Petitessen zur Kreativkultur im Prenzlauer Berg oder Tratsch über Peter Zadeks Porno-Comic als Geschenk für den Krebskranken gibt's auch.
Laberenz hat Schlingensiefs Tonbänder und Mitschnitte seiner Lese-Auftritte während des letzten Lebensjahres zu einem Text komponiert, der ohne chronologische Ordnung Rückschau mit Reflexion verbindet, kurze Einwürfe zum Krankheitsverlauf neben Ideen für kommende Werke stellt. Herrliche Petitessen zur Kreativkultur im Prenzlauer Berg oder Tratsch über Peter Zadeks Porno-Comic als Geschenk für den Krebskranken gibt's auch.
Die frühen Filme wie "Menu Total" und politische Arbeiten wie die Aktion "Bitte liebt Österreich" (der "Ausländer raus!"-Container) bei den Wiener Festwochen 2000 sowie die Parteigründung "Chance 2000" zum Eingriff in den Bundestagswahlkampf 1998 rücken ins Zentrum. Unter den Theaterarbeiten widmet Schlingensief dem Bayreuther "Parsifal" von 2004 die größte Aufmerksamkeit, verbunden mit herrlichen Innenansichten zum alltäglichen Wahnwitz bei Wagnerns. Und das Großprojekt der letzten Jahre, der Bau des Operndorfs in Burkina Faso, kommt natürlich quasi leitmotivisch vor.
Fotos und Dokumentarmaterialien (u.a. ein Schüleraufsatz zum Berufswunsch "Filmregisseur") sind in den Haupttext eingelassen, ebenso der lange User-Kommentar von Schlingensief auf nachtkritik.de, der auf Esther Slevogts kritischen Blog zum Operndorf Der Onkel auf der Sänfte antwortet. Da sieht man den begnadeten Medienzampano noch einmal in Höchstform: etwas bissig, etwas werbend, manchmal wehleidig, immer furios. Überhaupt ist vom leicht in sich gekehrten Gestus des Krebstagebuchs kaum etwas übrig. Das Buch ist hell, kraftvoll. Laberenz hat den Duktus der mündlichen Rede, die gern spontanen Inspirationen folgt, bestens bewahrt.
Herrlich irritierend
Und so erscheint Schlingensief denn durchweg als packend sinnlicher Erzähler, dem in kleinen Anekdoten, in Bildern und abseitigen Erlebnissen künstlerische Ideen aufleuchten. Aus seinen frühen Kindheitstagen 1968 berichtet er die "Urszene" seiner Arbeit: Da hatte sein Vater als Hobbyfilmer einen Streifen mit Strandurlaubsbildern doppelt belichtet, sodass bei der Projektion plötzlich fremde Menschen über den Bauch von Mutter und Sohn liefen. Diesen "Überblendungen und Mehrfachbelichtungen", dieser "Revolution der Irritation", ist der Künstler später gefolgt. Er hat das Unverbundene verschmolzen, das Heilige und das Profane, das Hehre und Alberne, das Politische und den Zirkus. Da lag der surrealistische Impetus seines Schaffens.
"Ich bin irgendwann im Eis stecken geblieben, ich bin nicht zum Nordpol gekommen, ich habe nicht den Mond erreicht, ich habe meine politischen Ansichten nicht durchsetzen können, ich habe auch keine Massenbewegung erzeugt, ich habe keine Kunst kreiert, die sich durchsetzen wird", schreibt Schlingensief einmal. Aber was hieße das schon: ans Ziel gelangen?
Das Buch sucht keine Vollendung, es kreist, es schließt mit dem Entwurf eines Drehbuchs (in Kollaboration mit Oskar Roehler), das Schlingensief nicht mehr realisieren konnte: Der Krebstod eines Regisseurs, zu spielen von Milan Peschel, der zu seiner letzten großen Party einlädt. Am Schluss taucht Gott als Hund auf, auf der Rückbank eines Cabrios.
"Ich weiß, ich war's". Dieser Buchtitel hat nichts Definitives. Es ist eher das Bekenntnis eines Täters, eines Schelms, der sagt: Ich hab's gemacht, ich hab' zugegriffen. Er kam wie ein Dieb in der Nacht und hat uns unsere Sinne geraubt. Und sie verwandelt zurückgegeben.
Christoph Schlingensief: Ich weiß, ich war's, hg. von Aino Laberenz,
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012, 291 Seiten, 19,99 Euro
Mehr Bücher, mehr Rezensionen: hier entlang.
mehr bücher
meldungen >
- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral
- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"
- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben
- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant
neueste kommentare >
-
Rücktritt Würzburg Nachtrag
-
Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin
-
Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt
-
Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich
-
Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin
-
Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?
-
Landesbühnentage Kleinmut
-
Kolumne Wolf Autorenvereinigungen
-
Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich
-
Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg



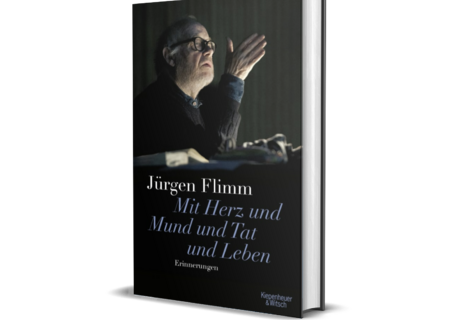









deutschen Theaters" etc. weggelassen haben - man hatte ja in den
letzten 12 Jahren von Schlingensiefs Leben natürlich zunehmend das
Gefühl, dass er einem entwendet wird vom Kulturbetrieb - aber auch, dass es dem Entwendete selbst eine große Freude und Genugtuung erbrachte, sich da eingeschmuggelt zu haben wie ein Findling aus einer ganz andren Welt, einer surrealistischen Super-8-Kinderwelt. Wie sehr er doch die Gegenwart geprägt hat, das merkt man daran, wie sehr er jetzt fehlt - da steht er dann auf einmal in einer Reihe mit Bertolt Brecht, Heiner Müller, Einar Schleef - ob er sich selbst in dieser Linie gesehen hat? Wohl kaum. (Eher mit Faßbinder, Alfred Edel, Werner Schroeter.) Schlingensief war immer doppelt, während er einen volllaberte stand er gleichzeitig hinter sich selbst und hat das gefilmt - manchmal, manchmal steht er immer noch da...