Junge Stücke - Ein Band zur jungen deutschen Dramatik von Andreas Englhart und Artur Pełka herausgegeben
Souveränität wegnehmen
von Christian Baron
21. Juli 2014. Glaubt man Florian Kessler, dann ist die deutsche Gegenwartsliteratur zu brav und zu konformistisch. Eine Erklärung, woran das liegt, schob der Kulturjournalist in seinem viel diskutierten Kommentar in der "Zeit" zu Anfang des Jahres auch gleich nach: Jene durch die Schreibschulen von Leipzig bis Hildesheim ausgespuckte Generation junger Autorinnen und Autoren entstamme einem saturierten Mittelklasse-Milieu. Mangels Lebenserfahrung dominiere daher belangloses Gedöns die literarische Republik; relevante Welthaltigkeit sei praktisch inexistent. Gewiss nicht bewusst, aber doch sinnvoll reiht sich eine soeben erschienene wissenschaftliche Publikation in die daraus entstandene hitzige Feuilleton-Debatte ein.
"Junge Stücke" betitelten die Theaterwissenschaftler Andreas Englhart und Artur Pełka den von ihnen herausgegebenen Sammelband, der auf einer internationalen Fachtagung zur Situation und zu den Theatertexten insbesondere deutschsprachiger Jungdramatiker beruht. Schon in der Einleitung bescheinigen sie den Autoren "eine breite dramenästhetische Vielfalt". Sie konstatieren aber auch, dass sich die Spielhäuser textlichen Nachschub "auffallend häufig" von Absolventen der Studiengänge "Szenisches bzw. Kreatives Schreiben" holen. Engelhart und Pełka erscheint es dabei jedoch ausnehmend wichtig, den Nachwuchs vor den in der Debatte schwelenden Vorwürfen von formaler Diffusität und inhaltlicher Bedeutungslosigkeit in Schutz zu nehmen.
Neues politisches Theater?
So sei es "fast unfair und ein bisschen gemein", den Talenten ihre privilegierte soziale Herkunft vorzuwerfen. Zumal die Stadttheater durch miserable Arbeitsbedingungen ohnehin systematisch all jenen das Ankommen im künstlerischen Beruf erschweren, die keine  finanzielle Unterstützung durch die Eltern erhalten können. Überdies habe es diese "pragmatische Generation" schwer, in Nachfolge der aufsässigen Klassiker von Schiller bis Büchner oder der 68er "eine in der Rebellion sich dialektisch ausprägende, eigene Identität zu finden". Dass sie genau danach händeringend suchen, zeigen die zahlreichen sich anschließenden Analysen und Interpretationen.
finanzielle Unterstützung durch die Eltern erhalten können. Überdies habe es diese "pragmatische Generation" schwer, in Nachfolge der aufsässigen Klassiker von Schiller bis Büchner oder der 68er "eine in der Rebellion sich dialektisch ausprägende, eigene Identität zu finden". Dass sie genau danach händeringend suchen, zeigen die zahlreichen sich anschließenden Analysen und Interpretationen.
Wie geschaffen erscheint inmitten der generativen Orientierungslosigkeit der Trend jener Jungstars, ein "neues politisches Theater" zu kreieren mithilfe der Tendenz zu Postmoderne und Postdramatik, welche die Autoren der Fallstudien fast durchweg zustimmend und lobend feststellen. Als zentrale Elemente der Gegenwartsdramatik diagnostizieren die Beiträge dementsprechend die Dekonstruktion beispielsweise von Geschlechtskategorien (John Birke), das Aufbrechen vormals eherner formaler Ingredienzen wie Dialog/Konflikt/Finalität/Abgeschlossenheit (Philipp Löhle), den Wunsch nach sprachlicher Zerstreuung von Macht (Martin Heckmanns), die Abwesenheit von Belehrung und Agitation (Rimini-Protokoll) sowie die formale und inhaltliche Rätselhaftigkeit selbst jener Texte, die sich explizit mit Ökonomie befassen (Ewald Palmetshofer).
Feurige Selbstverteidigungsrede des Juniors
Wenngleich Hans-Peter Bayerdörfer den jungen Stücken eine "magmatische Formenvielfalt" zwischen "gezieltem Experiment und nicht weniger gezieltem inhaltlichem Engagement" attestiert, belegen die im Buch versammelten Texte doch die Thesen des prominenten Dramaturgen Bernd Stegemann, der in seiner "Kritik des Theaters" (2013) gegen die seiner Meinung nach vorherrschende postmoderne Darstellungs- und Inszenierungspraxis wütet, welche vor der Komplexität des Kapitalismus kapituliere und nach dem Motto verfahre: "Man kann nichts mehr aussagen, aber das sieht sehr schön aus."
Nicht nur die oftmals fehlende kritische Distanz zu den besprochenen Stücken, sondern auch das Ausblenden junger Autoren wie etwa Milo Rau, die dem postdramatischen Theater ablehnend gegenüberstehen, lassen diesen erkenntnisreichen, wenn auch quantitativ überfrachteten Band wie eine unprätentiöse Apologetik der in die Defensive zu geraten drohenden Lieblinge deutscher Förderpreisjurys erscheinen. Dazu passt auch der abschließende Beitrag des Bandes, in dem mit Nis-Momme Stockmann einer der zuvor untersuchten Junioren selbst das Wort ergreift – und zu einer feurigen Verteidigungsrede seiner Autorengeneration anhebt.
"Scheiß Souveränität im Umgang mit der Welt"
Das Theater warnt er vor dem "Verschwinden des Autors", das zwangsläufig erfolge, wenn an die Schreibenden weiterhin Ansprüche wie mehr Realismus, mehr Verständlichkeit und mehr Welthaltigkeit herangetragen werden. Hollywood ist sein Negativexempel, weil es zeige, "wie Kunst ist, wenn sie der Gier nach dem Signifikat, nach dem konsumierbaren Sinn, freien Lauf lässt – ein Film arrangiert sich um eine plakative, eine redundante Prämisse". Sie müsse "redundant sein, sie muss dem Kanon entstammen, andere müssen sie bereits für uns verstanden haben". Eine tiefe Abneigung empfindet er gegen das Verständnis politischen Theaters als Instanz der Parteilichkeit und als Vermittlerin klarer Botschaften: "Ich möchte niemandem etwas geben. Ich möchte den Menschen eher etwas wegnehmen – die scheiß Souveränität im Umgang mit der Welt".
Stockmanns Beitrag rundet damit die Anthologie stimmig ab, indem er eloquent der von Kessler monierten Bürgerkinder-Anspruchslosigkeit widerspricht und sich emphatisch gegen die von Stegemann erhobene Forderung nach mehr Realismus im subversiven Spiel verwahrt. Denn er bleibt "lieber dumm und auf der Suche, als im Gefängnis der Proklamation für immer der Ästhetisierung des Bekannten und der Reproduktion unserer Kausalitäten dienen müssen".
Andreas Englhart, Artur Pełka (Hg.):
Junge Stücke. Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater
Transcript Verlag, Bielefeld, 2014, 416 S., 35,99 Euro.
mehr bücher
meldungen >
- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral
- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"
- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben
- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant
neueste kommentare >
-
Rücktritt Würzburg Nachtrag
-
Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin
-
Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt
-
Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich
-
Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin
-
Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?
-
Landesbühnentage Kleinmut
-
Kolumne Wolf Autorenvereinigungen
-
Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich
-
Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg



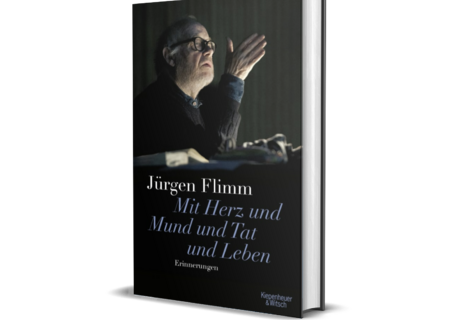









Wir können ja auch - und auch ICH würde dafür plädieren - zu Sartres späterem "Konkurrenten" des Existentialismus zurückkehren, zu Camus, der da sagte, dass der Existentialismus ein HUMANISMUS sei:
"Er wollte froh sein, war es auch irgendwo in seiner Eitelkeit, und doch, als er sich beim Verlassen des grünen Feldes nach Munoz umdrehte, legte sich ihm beim Anblick des fassungslosen Gesichts dessen, den er geschlagen hatte, plötzlich eine düstere Traurigkeit aufs Gemüt. Und so begriff er, daß der Krieg nicht gut ist, da einen Menschen zu besiegen ebenso bitter ist, wie von ihm besiegt zu werden."
Ebenso hier, und jetzt alle nochmal nachdenken:
"Später sollte er sich an diese Geschichte erinnern, als er (wirklich) begriff, daß die Menschen so tun, als respektierten sie das Recht, und daß sie sich nur der Macht beugen."
Beide Zitate aus: Camus, "Der erste Mensch".