Debatte um die Zukunft des Stadttheaters – Warum Ensembletheater tragende Säulen der deutschsprachigen Theaterlandschaft sind
Wir sind alle Ensemble
von Thomas Bockelmann
26. Mai 2015. Erinnert sich noch jemand an die Sokal-Affäre? An jenen ehrfurchtsgebietenden Essay mit dem Titel "Transformative Hermeneutik der Quantengravitation"? Frisch erschienen, platzte schon die Bombe. Der Text entpuppte sich bei genauer Lektüre als sinnfreie Collage philosophisch verbrämter Physikbegriffe. Der Physiker Alan Sokal hatte das bei Teilen der Soziologie beliebte Cross-Over von Geistes- und Naturwissenschaft entlarven wollen als das, was er letztlich selber produzierte: elegante, heiße Luft.
Das Resultat war ein handfester Streit dies- und jenseits des Atlantiks: Analytiker droschen auf Postmoderne, Rationalisten auf Intellektuelle, und vice versa. In diesem Krieg der Köpfe schrieb Bruno Latour eine gleichermaßen schöne wie denkwürdige Erwiderung an Sokal. Warum, so Latour, bekämpften sich Disziplinen, Natur- und Kulturwissenschaften, die eigentlich doch im gleichen Boot säßen? Gäbe es nicht gemeinsame Gegner, die Absolutisten beispielsweise? Es sei doch klüger, ohne Arroganz oder Minderwertigkeitskomplex solidarisch zu sein, als logische Verbündete möglichst geistvoll sturmreif zu schreiben.
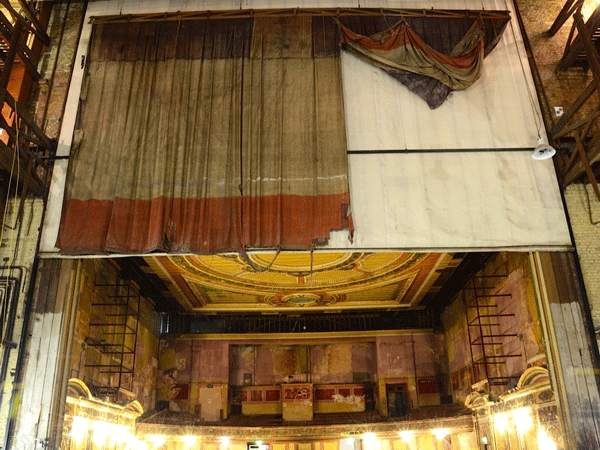 Siechtum der Institution? Verlassenes Theater im Alexandra Palace, London © Simon Leigh | The Guardian
Siechtum der Institution? Verlassenes Theater im Alexandra Palace, London © Simon Leigh | The Guardian
Spaltung des sozialen Feldes Theater
Nicht lange her, da war es en vogue, über das Stadttheater in medizinischem Jargon zu berichten. Man malte, in stetig kleinen Dosen, das Bild einer siechen Institution – und wer den Befund nicht einsehen wollte, stand als uneinsichtiger Patient da, mit dem die Geduld zu verlieren jeder das gleichsam verbriefte Recht besaß. Auf einmal ähnelten die Bühnen dem deutschen Sozialstaat, jenem "kranken Mann Europas", zu teuer, zu starr, utopielos. Dem sprangen Fachleute der Theatertheorie bei: Diese Diagnose sei seit Langem schon virulent, das Stadttheater ein aufgeblähter Invalider in rosabürgerlicher Scheinwelt, zu heilen im Grunde nur durch Rosskuren in postrepräsentativen Seminaren. Gelänge dies nicht, was anzunehmen sei, drohe – so die behandelnden Theaterärzte – besonders bei mittleren und kleinen Häusern nur noch: chronische Provinz.
Derlei Denkart befremdet, befördert sie doch eine Spaltung des sozialen Feldes "Theater", zwischen Bühnen, Theoretikern, Journalisten und Kulturpolitikern, die doch, so Latour, alle "zu sehr vermischt und zugleich sehr zerbrechlich" seien. Und zwar angesichts eines Absolutismus', den der (ehemalige) U.S.- Präsidentschafts-Kandidat Mitt Romney in einem Anflug von offenherzigem Versailles auf den Punkt brachte: "Die Ärmsten sind mir völlig egal". Der Markt sei ja gerecht. Und nun sind alle Kassen klamm; gespart und outgesourced wird nicht nach Vernunft, sondern dort, wo es halt möglich ist. Umso besser, wenn sich dieser hässliche Umstand diskursiv aufhübschen lässt: Stadttheater seien nicht nur teuer, sie befänden sich auch ästhetisch nicht mehr auf der Höhe.
Unter dem Deckmantel der Diskussion um Chris Dercon
An diesem Punkt musste die Großzügigkeit enden. Das Neoliberale saugte genüsslich Honig ausgerechnet aus der Neoavantgarde. Geschickt schreitet man von der "Dekonstruktion" zur "Deregulierung" aller Strukturen. Um dann, im atemberaubenden Salto, das Theater gegen es selbst zu wenden: Der "normale Bürger" brauche in seiner Freizeit kein ästhetisch-elitäres Bizarrtheater, sondern Entspannung, Wellness, Lachkonserven – um aber, das ist der perfide Hintersinn des Marktfundamentalismus, im Job zu funktionieren. Das Unterhaltungsdelirium als Triebfeder einer sich demokratisch und humanistisch gebärdenden Totalentfremdung. Doch wie sagte einmal eine kluge Kurtisane: Geld ist, genau wie der Sex, wohl ein guter Diener, aber ein sehr schlechter Herr.
Verdeutlicht wird dies durch ein aktuelles Beispiel. Zunächst hatten wohl einige Kollegen gehofft, die Berufung Chris Dercons zum Intendanten der Volksbühne sei eine weitere Sokal'sche Fälschung. Dass die Politik den schon kühnen Schritt getan hat, die Ära Castorf abzulösen, verdient gleichwohl Interesse, zumal Dercon in seinem Metier von unbestreitbarer Qualifikation ist. Und da die Bildende Kunst oft genug starke Impulse ins Theater sandte, darf man neugierig sein auf seine Intendanz. Wesentlicher aber war das, was unter dem Denkmantel der Dercon-Diskussion fast unmerklich hervorkroch. Einige Akteure konnten nicht widerstehen, eine Debatte gegen das Ensembletheater zu lancieren, die genau betrachtet geeignet ist, das Theater-"Boot" insgesamt zu beschädigen.
 Was macht das deutschsprachige Theater aus? Unter anderem: das feste Ensemble. Dieter Dorns
Was macht das deutschsprachige Theater aus? Unter anderem: das feste Ensemble. Dieter Dorns
Ensemble verabschiedet sich im Juli 2011vom Publikum des Bayrischen Staatsschauspiels.
© Thomas Dashuber
Aus Künstlern Kapitalisten machen
Die Frage stellt sich erneut: Was macht das deutschsprachige Theater aus? Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist die historisch gewachsene Infrastruktur vieler Spielstätten; die öffentliche Förderung von Kunst, was demokratisch den Theaterbesuch vom Einkommen entkoppelt; eine progressive Kultur ästhetischer Forschung in Theaterinstituten, Symposien und Festivals; sein experimentierfreudiges Spektrum vom Literarischen bis zum Performativen; die Tradition der festen Ensembles an den Stadt- und Staatstheatern. Es spricht vieles dafür, dass dieser Reichtum garantiert wird eben durch die festen Ensembles. Wo diese fehlen, das zeigt der internationale Vergleich, ist Theater schutzloser gegen das süße Gift des Ökonomismus, dem die Politik in Krisenzeiten nur allzu gerne erliegt. Ein Gift, das die Droge einer erzkonservativen Agenda ist, die keine mündigen Menschen, sondern funktionierende Insassen einer "Braven neuen Welt" erziehen will.
Man nehme die Niederlande, wo die rechte Regierung sich 2013, ohne mit der Wimper zu zucken, aus der Förderung der Produktionshäuser zurückzog, was bald zur Erosion des Angebots und damit zur Erschlaffung der Publikumsakzeptanz führte. Beachtung verdient in diesem Kontext das geflügelte Wort "Doing a Newcastle": ein Sparprogramm von 100 Prozent wäre in der englischen Industriemetropole beinahe Realität geworden. Abseits von London werden britische Theater im Überlebenskampf zu Musicals und Shows gezwungen, was Lorne Campbell jüngst den (absurden) Plan nannte, aus Künstlern Kapitalisten zu machen – "schleichend die Sicht auf das zu reduzieren, was möglich ist", Kreativität mit dem Mantra "Denkt nicht zu groß" zu brechen. Der Beifall des reaktionären Wählers sei dem schlauen Politiker gewiss: "Gut, dass dieser Mist gestrichen wird!" Kein Zufall, dass die AfD etwa in Trier "Schluss mit dem Theater" fordert, zugleich Rednern wie Geert Wilders, dem (un)geistigen Vater des niederländischen Kahlschlags, das Wort erteilt. Was macht das deutschsprachige Theater aus? Die Idee des Ensembles, die harmoniert mit der Suche
Was macht das deutschsprachige Theater aus? Die Idee des Ensembles, die harmoniert mit der Suche
nach Vernunft und Austausch in der Gemeinschaft. Im Juli 2011 verabschiedet sich das Publikum des
Bayrischen Staatsschauspiels von "seinem" Ensemble. © Thomas Dashuber
Widerständige Ensemble-Idee
Gebäude kann man umwidmen. Gelder umlenken. Festivals streichen. Lehraufträge auflösen. Aber ein Festes Ensemble ist vertraglich geschützt, juristisch widerständig. Auch ist eine solche Gemeinschaft von Schauspielern und Schauspielerinnen klarer, sozialer Bestandteil einer Stadtgesellschaft. Der Wegfall kann nicht heimlich, ohne Aufsehen geschehen. Und das feste Ensemble ist mehr als ein Modell. Modelle wechseln, wenn sie eine Realität empirisch oder volkswirtschaftlich nicht mehr zulänglich abbilden. Das Ensemble ist vor allem eine Idee. Und Ideen sind widerständig. Sie beschreiben Wirklichkeit nicht nur, sie gestalten sie. Die Idee des Ensembles harmoniert mit der Idee, dass die Suche nach Vernunft stets Suche ist nach Gemeinschaft. Das Ensemble ist Symbol dafür, dass ich Gedanken nur im Austausch mit anderen als vernünftig erproben kann.
Daher rührt der Impuls vieler Theaterkünstler, Gruppen zu formen und zu finden, von Shakespeare bis in unsere Gegenwart. Das deutschsprachige Theater hat diesen Impuls zur Institution erhoben. Besonders in den mittleren und kleinen Städten ist das Ensemble mitentscheidend dafür, dass eine Stadt von "ihrem" Theater sprechen kann. Identifikation verlangt Wiedererkennen, Kreativität das Sich-Erinnern. Insofern steht das feste Ensemble auch für das Repertoire des Dramatischen, der Säule unseres Theaters neben dem Postdramatischen, der Performance. Dies sind die Pole, zwischen denen in vielen Schattierungen sich jedes Theater bewegt, zwischen Präsenz und Ritual, zwischen Dialog und Figur. Das Erzählen von Geschichten nun, so Paul Ricoeur, bewegt sich immer im Feld präfigurierter Fabeln, die jeder kon- und refigurieren kann. Dies ist dem Drama eigen und auch dem Ensemble, das mit dem Wiedererkennbaren spielt, ihm seine Gesichter verleiht, zu Neubewertungen gelangt.
 Nur Leibeigene? Wanderarbeiter zwischen Tankstellen in der Wüste? Nur die lower class des Spielvolkes? Oder doch eher Garant des Dramatischen und Agent der Identifikation? Schauspielensemble des Staatstheaters Kassel © Collage Isabelle Winter | Staatstheater Kassel
Nur Leibeigene? Wanderarbeiter zwischen Tankstellen in der Wüste? Nur die lower class des Spielvolkes? Oder doch eher Garant des Dramatischen und Agent der Identifikation? Schauspielensemble des Staatstheaters Kassel © Collage Isabelle Winter | Staatstheater Kassel
Identifikation mit dem Aggressor?
Umso kritischer ist es, wenn nicht mehr konservative Politiker und Marktideologen die Blaupause für die Attacke auf die Ensembles schreiben, sondern Kulturjournalisten oder Theatermacher. Man ätzt nicht mehr medizinisch, sondern progressiv über "Nostalgie", "Romantik", "Leibeigene", "Wanderarbeiter zwischen Tankstellen", die abseits der "upper-class" finanziell besser ausgestatteter Theater ohnehin keinen substantiellen Beitrag leisten.
Haben wir nicht von Foucault gelernt, dass ein Text seinem Autor immer entkommt? Speziell im Google-Gedächtnis, das nichts vergisst und nichts verzeiht, wirkt eine Einzelmeinung umso "nachhaltiger", je schriller sie klingt. Man geriert sich auf der Höhe des Diskurses, beschwört ein totales, rein agiles Post-Ensemble-Theater. Man sollte schauen, wer da so lautstark die festen Ensemble in der Weite der Theaterlandschaft beschießt. Kulturjournalisten, denen ihr Ensemble, (die Redaktionen), im Dienste von Profitabilität wegschrumpfen? Theatermacher, die sich vergeblich um die Leitung von Ensembles bewarben? Könnte man hier schon von der Identifikation mit dem Aggressor sprechen?
Ist es nicht paradox, das Performative, seine ästhetische Durchbrechung der Regel, zur Regel zu machen, seine Differenz kollabieren zu lassen? Ist es seriös, nur ein Vokabular zur Überprüfung von Theorien zu entwickeln, und so man feststellt, dass es zur Beschreibung der mimetischen Kunst von Schauspielern nicht gemacht ist, diese als unzeitgemäß zu geißeln? Ist es nicht ein ideologisch falsches Bewusstsein aus dem Bilderbuch, jenem Theater in Bausch und Bogen die Voraussetzung für Innovation abzusprechen, wo Regisseure, Schauspieler und Zuschauer erste Erfahrungen und Kontakte sammeln, wo der Dialog mit der Gesellschaft vor Ort geführt wird, mit dem ganz eigen justierten Blickwinkel auf den Ort und von dort auf das Ganze?
Verloren für immer?
Mag sein, es klingt für manchen nostalgisch, aber soviel Zeit es braucht, ein Ensemble zu etablieren, soviel Zeit braucht es wohl, das auch zu lernen. Umsetzung und Pflege dieser Idee ist anspruchsvoll. Es gibt Gründe, warum nicht alles sich via Bachelorcredits verkürzen lässt. Eine misslungene Ensemblepolitik kann, prominentes Beispiel war das Burgtheater, sogar eine Intendanz sprengen. Ein einmal aufgelöstes Ensemble kehrt in unserer rasanten Epoche nicht zurück. Eine geschlossene Sparte ist verloren für immer: Die Zeit, die in ihr steckt, lässt sich nicht synthetisch wiederherstellen. Apropos Zeit. Angeblich hat das ganze moderne 20. Jahrhundert nur eine einzige neue erotische Technik erfunden. Die Beschränkung auf diese, der Verzicht auf ein lebendiges Erbe dürfte wahrhaft unerotisch werden.
Latour hatte seine Kollegen ermahnt, zu respektieren, in welchem zerbrechlichen Boot man gemeinsam sitzt. Ensemble gegen Performer, Drama gegen Environment, Intendanten gegen Kuratoren auszuspielen, das schwächt das Theater insgesamt. Der Bedeutungsverlust der einen ist der Bedeutungsverlust der Anderen. Letztlich sind wir alle Ensemble.
 Thomas Bockelmann ist seit 2004 Intendant des Staatstheaters Kassel.
Thomas Bockelmann ist seit 2004 Intendant des Staatstheaters Kassel.
Zuvor leitete er das Tübinger Zimmertheater, die Landesbühne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven und die Städtischen Bühnen Münster.
Alle Texte, die bisher im Rahmen der Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de erschienen, sind im Lexikoneintrag gelistet.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.













