Nachtasyl - Michael Thalheimer zeigt an der Schaubühne, wie schlecht der Mensch ist
Kanalratten
von Leopold Lippert
Berlin, 6. Juni 2015. Ganz unten, da ist nur mehr ein dreckiges Kanalrohr, ohne Ausgänge, bloß ein kleiner Spalt an der Oberseite. Nach und nach plumpsen die Schauspieler*innen auf die Bühne, wie frisch den Abfluss hinuntergespült, rappeln sich auf, suchen nach Halt, rutschen auf der Scheiße aus und starren erschöpft ins Leere. Das quergezogene Bühnenbild von Olaf Altmann kennt kein Außen: dieses "Nachtasyl" ist Klaustrophobie im Breitwandformat. Und auch dem monotonen Gewummere von Bert Wrede entkommt niemand: Der über neunzig Minuten fast durchgängige auf- und abschwellende Gitarrensound ist, gelinde gesagt, nervtötend.
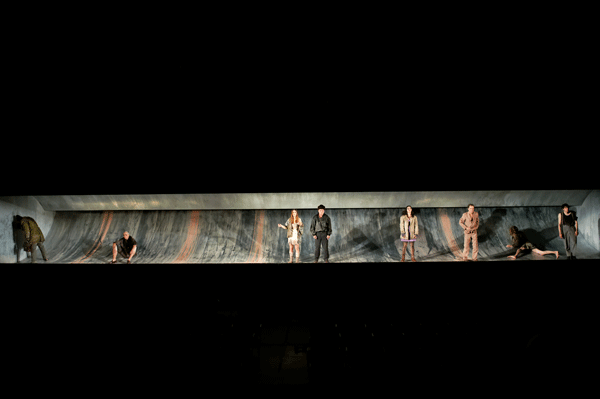 Ganz unten im Kanalrohr (von links): David Ruland, Ingo Hülsmann, Alina Stiegler, Peter Moltzen, Eva Meckbach, Felix Römer, Bernardo Arias Porras, Christoph Gawenda. © Katrin Ribbe
Ganz unten im Kanalrohr (von links): David Ruland, Ingo Hülsmann, Alina Stiegler, Peter Moltzen, Eva Meckbach, Felix Römer, Bernardo Arias Porras, Christoph Gawenda. © Katrin Ribbe
In der Scheiße röcheln immer die anderen
"Nachtasyl", Maxim Gorkis tief pessimistischer Welterklärungsversuch vom unteren Ende des gesellschaftlichen Spektrums, erzählt von Vereinzelung, Verwahrlosung und falschen Versprechungen. Doch während Gorki ambivalent zwischen (gesellschaftlich bedingter) Verrohung und (individualisierter) Bosheit oszilliert, hat sich Michael Thalheimers Inszenierung an der Schaubühne eindeutig für Letztere entschieden. Hier sind alle fiese Oberschurken, und damit man das auch gleich kapiert, knurren und fauchen und röcheln und brüllen und krächzen und meckern die Schauspieler*innen um die Wette.
Über weite Strecken wirkt das wie ein deftiges Irrenhausklischee aus einer Zeit, in der man noch Irrenhaus sagen durfte. Da wird hysterisch gekichert, unzusammenhängend monologisiert, ordentlich Rotz hochgezogen, rumgespuckt, uriniert, masturbiert, und dauernd unmotiviert drauflosgebrüllt. Dazu gibt's fettige Haare, dreckig glänzende Haut, jede Menge Blut, und zerfetzte farblose Lumpen (Kostüme: Nehle Balkhausen).
Vor allem aber können sich die Zuschauer*innen bei soviel Distanzmoment in voyeuristischer Sicherheit wiegen. Wir sind hier nämlich nicht gemeint! Da kann der kalte Scheinwerfer noch so hell in den Saal leuchten, bevor es losgeht; da können die Figuren ihre schaurigen Sentenzen noch so frontal Richtung Publikum deklamieren; da kann man noch so viele Seiten Wolfgang Streeck über den allumfassenden bösen Kapitalismus ins Programmheft drucken: Ganz unten in der Scheiße, das sind immer die anderen!
 Da lässt sich nichts schönreden: Jule Böwe als Vasilisa und Christoph Gawenda als Pepel auf dem Weg zur Vergewaltigung © Katrin Ribbe
Da lässt sich nichts schönreden: Jule Böwe als Vasilisa und Christoph Gawenda als Pepel auf dem Weg zur Vergewaltigung © Katrin Ribbe
Alles egal, am Ende Kanal
Einen Vorteil hat das natürlich schon: Durch die fratzenhafte Figurenzeichnung kann Thalheimer die Welt noch viel schlechter machen, als sie bei Gorki ohnehin schon ist. Es tut ja dann nicht so weh. Luka etwa, im Text durchaus ein – wenn auch problematischer – Hoffnungsträger, ist hier schon vom ersten Moment an ein verbitterter Zyniker. Auch wenn Tilman Strauß im unschuldsweißen Schlabberanzug auftritt, spricht er gepresst und voller Abscheu: sein Luka hat kein Mitleid, er lügt nicht wohlwollend, um andere aufzumuntern; er spult bloß hohle Phrasen ab und röchelt seine Gleichnisse emotionslos, formelhaft wie in einem drittklassigen Horrorfilm ("Wenn man im Richtigen Moment Mitleid hat, kommt man am weitesten."). Und da ist es nur konsequent, dass er es ist, der die todkranke aber lebenshungrige Anna (Alina Stiegler) erst begrapscht und dann erwürgt.
Oder Vasilisa (Jule Böwe), die geschasste Liebhaberin, die durch knallhartes Kalkulieren eigentlich die strategische Oberhand behält. Bei Thalheimer muss sie sich trotzdem ihr sexy Kleidchen ausziehen, damit sie sich von Pepel (Christoph Gawenda) vergewaltigen lassen kann. Und schließlich ist da der Schauspieler (Felix Römer), der seine Mitmenschen nur dann wirklich wahrnimmt, wenn er spielt und Gedichte oder Dialogzeilen vorträgt. Weil er nur als Schauspieler Pathos auftragen darf, kann er nur als Schauspieler sterben. "Ich gehe jetzt. Ab!", sagt er am Ende, bevor er wirklich abgeht und sich aufhängt.
Wenn man Thalheimer also eine These unterstellen wollte, dann die, dass man sich eine derart schlechte Welt gar nicht schönreden kann, selbst wenn man es wollte. Und dass es vollkommen egal ist, ob man dieser Wahrheit ins Gesicht sieht oder ihr mit allerlei Heilsversprechen zu entwischen versucht; am Ende landet man ja doch immer wieder in einem Kanalrohr voll spritzender Scheiße. Die gute Nachricht dabei ist: Mit uns hat das zum Glück nichts zu tun.
Nachtasyl
von Maxim Gorki
Fassung von Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens nach der Übersetzung von Andrea Clemen
Regie: Michael Thalheimer, Bühne: Olaf Altmann, Kostüme: Nehle Balkhausen, Musik: Bert Wrede, Dramaturgie: Bernd Stegemann, Licht: Erich Schneider.
Mit: Jule Böwe, Christoph Gawenda, Ulrich Hoppe, Ingo Hülsmann, Eva Meckbach, Peter Moltzen, Lise Risom Olsen, Bernardo Arias Porras, Felix Römer, David Ruland, Andreas Schröders, Alina Stiegler, Tilman Strauß
Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause.
www.schaubuehne.de
Thalheimer stelle die Figuren "schonungslos und anti-psychologisch" aus, schreibt Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung (8.6.2015): "Aus einer Art Schaufenster blicken sie frontal ins Publikum, als wollten sie sagen: Ihr wollt einen Elendsporno? Bitteschön, da habt ihr ihn." Thalheimers "bewährtes Prinzip, über Marotten und maximale Künstlichkeit zum Kern einer Figur vorzudringen", funktioniere aber diesmal nicht recht. "Man schaut diesen Menschen tatsächlich ein bisschen zu wie Tieren im Zoo. Sie bleiben merkwürdig fremd."
"Eine schartige Menschenausstellung (...), die nur Menschen des gleichen Verzweiflungsschlags kennt" hat Dirk Pilz gesehen und schreibt in der Berliner Zeitung (8.6.2015): Thalheimer erweise sich mit dieser Inszenierung "als Aktivist im Mantel des Als-ob". "Aber das schiere Ausstellen oder Konsumieren von Schreckensbildern und Elendszuständen ist weder Gesellschaftskritik noch Arbeit an der Suche nach Auswegen", so Pilz, sondern "Schulterklopferei, die den Verhältnissen für ihre Schlechtigkeit dankt, weil man damit so herrlich wider sie wettern kann".
In seiner "heiß-kalt vibrierenden Inszenierung mit dem famosen, leidenschaftlich und gescheit aufspielenden Ensemble" erlaube Michael Thalheimer "weder Samowar-Romantik noch Tränendrüsen-Elan", findet hingegen Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (8.6.2015). Er zeige vielmehr "die Facetten des Niedergangs in einer melodisch chaotischen, aber souverän rhythmisierten Partitur, die Schmerz und Wut, Begierden und Aggressionen in kleinen und größeren Gruppenbildern als Stereotypen der Zerstörung gestaltet". "'Wozu lebt ihr, wozu?', brüllt der Schauspieler irgendwann entnervt seine Mitbewohner an", so Bazinger, und Michael Thalheimers Inszenierung gelinge es in ihrer "kunstvoll skulpturhaften Meisterlichkeit", dass die Frage bis heute durchdringe, "bis zu uns".
"Der konzeptuelle Weg über die symbolhaft gesteigerte Drastik führt dazu, dass die Dramatis Personae entmenschlicht werden, ausgestellt wie die Beutelratte in ihrem Bau", schreibt Katharina Granzin in der taz (8.6.2015). "Aber so ist es hier halt, zu differenzierten Äußerungen sind diese Menschen am alleruntersten Ende der sozialen Hackordnung nicht mehr fähig. Hoffnungsloser Abschaum eben." Das aber könne, so Granzin, kaum die Antwort sein auf "die zahllosen offenen Fragen, die Gorki mit diesem Stück hinterlassen hat". "Schließlich war der Mann Humanist."
"Zu Beginn schien es tatsächlich, als hätte Thalheimer dem Schaubühnen-Ensemble die nötige Härte verordnet", schreibt Christine Wahl im Tagesspiegel (8.6.2015): "Die ersten Sätze, die zwischen den Abgerutschten fallen, klingen wie ein einziger kollektiver Ohrfeigen-Austausch." Nur leider sei es mit der Strenge schnell vorbei, und "man verliert sich zusehends in der Unschärfe zwischen plakativ hergezeigter Verrohung und diffus gesellschaftsanklägerischem Pathos."
Thalheimer-Methode strebe "konzentrierte Verdichtung" an und verlange "ausdauernde Körper- und Stimmenvirtuosität", und für "sich genommen ist das alles eindrucksvoll". Allerdings, so wendet André Mumot auf Deutschlandradio Kultur (8.6.2015) ein, würden bei Gorki wie bei Tschechow die "unerhörtesten Dinge" gerade in einem "apathischen Konversationsfluss abgehandelt"; nur gelegentlich "branden große Gefühle auf", dann wieder sei "alles beim Alten, abgestumpft und barsch und roh und ganz und gar alltäglich". An diesem Gefälle "scheitert die Inszenierung, verfängt sich in der Absicht, aus jedem noch so banalen Satz etwas bedeutungsvoll Großes zu machen, mit jedem Stöhnen den Beweis für die Verkommenheit der Zivilisation zu liefern."
"Die zunehmend monoton in ihren Mitteln wirkende neunzigminütige Inszenierung entwickelt weder Spannung noch schauspielerischen Sog" und "der handwerklich souverän wilde Bühnenchic" mache kaum deutlich, "warum dieses Stück gespielt werden musste", sagt Hartmut Krug in der Sendung "Kultur heute" auf Deutschlandfunk (7.6.2015). "Expressivität und Lautstärke" seien die "Hauptstilmittel" der Darsteller. "Falsche Sentimentalität oder echte Gefühle, wie Mitleid, Trauer oder Schmerz, vermögen diese von Nehle Balkhausen schön skurril verkleideten Figuren mit ihrer fetzenhaften oder blutigen Kleidung weder beieinander noch beim Publikum hervor zu rufen."
Georg Kasch schreibt auf der Website von Welt Kompakt (9.6.2015): Olaf Altmann habe ein starkes Bild gebaut, das an seine Menschenpresse in "Die Ratten" von 2007 erinnere: es gebe eine "Enge und Bedrücktheit vor, aus der niemand entkommen kann." Während Gorki sein "Nachtasyl" durchaus als "klassenkämpferischen Aufruf gemeint" habe, wolle Thalheimer sich dem "nicht so ohne Weiteres anschließen"; bei ihm sehe man nur "Fratzen, Klischees, Karikaturen". Die Schauspieler übertrieben "entsetzlich", Thalheimers Theater sei im "Kitsch angekommen".
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.













