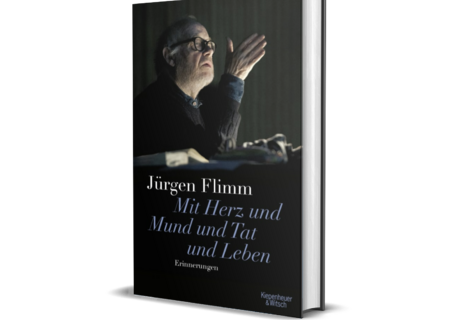Theater, Krise und Reform - Thomas Schmidts ambitionierte Studie zur Kritik des deutschen Theatersystems
Mammutaufgabe, machbar
von Dorothea Marcus
19. Januar 2016. Schwerfällige, unflexible Theaterbunker, unreformierbar, sagen die einen über das deutsche Stadttheatersystem. Leuchttürme der Kunst, weltweit einzigartig und beneidet, die anderen. Beide Aussagen erscheinen unvereinbar, und darin liegt der Kern der Krise: "Das Theater ist ein Ort, in dem sich Zustände konserviert haben, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, die das Theater abbildet", so Thomas Schmidt. Es sei eine Krise, die, wenn sie nicht aufgehalten wird, dazu führe, dass in 40 Jahren ein Drittel aller 141 deutschen Theater schließen. Noch beschleunigen wird sich das Theatersterben, wenn ab 2020 mit dem auslaufenden Solidarpakt II in Deutschland Sondermittel für den Osten entfallen – dabei befinden sich dort bereits jetzt die größten Theaterkrisen, man denke an Rostock, Dessau, Erfurt. Sicher hat auch unverantwortliche Kulturpolitik zu Raubbau und irreversibler Abwicklung geführt. Doch ein großer Teil der Krise liegt im System selbst.
 Auch im Westen wird die Lage zusehends dramatisch. Opernkarten, meint Thomas Schmidt, kosten 2040 mehr als doppelt so viel wie heute, dann sprießen in den "von den Städten verramschten Theatergebäuden die mit europäischen Mitteln geförderten Musicalhäuser aus dem Boden und bieten Einheitskost". Es treffe meist kleine und mittlere Theater – die großen seien durch hohe feuilletonistische Aufmerksamkeit weitgehend geschützt. Dabei wirtschaften sie bei weitem am Uneffizientesten. Im ach so strukturschwachen Osten leistet man sich etwa zwei große repräsentative Opernhäuser – Leipzig und Erfurt, während man zum Beispiel das Schauspiel sowie das Kinder- und Jugendtheater Erfurt 2003 geschlossen hat.
Auch im Westen wird die Lage zusehends dramatisch. Opernkarten, meint Thomas Schmidt, kosten 2040 mehr als doppelt so viel wie heute, dann sprießen in den "von den Städten verramschten Theatergebäuden die mit europäischen Mitteln geförderten Musicalhäuser aus dem Boden und bieten Einheitskost". Es treffe meist kleine und mittlere Theater – die großen seien durch hohe feuilletonistische Aufmerksamkeit weitgehend geschützt. Dabei wirtschaften sie bei weitem am Uneffizientesten. Im ach so strukturschwachen Osten leistet man sich etwa zwei große repräsentative Opernhäuser – Leipzig und Erfurt, während man zum Beispiel das Schauspiel sowie das Kinder- und Jugendtheater Erfurt 2003 geschlossen hat.
Man soll keine Neiddebatte führen? Das fällt schwer, wenn man sich vor Augen führt, dass etwa in Leipzig eine Opernvorstellung rund 200.000 Euro pro Abend kostet. Davon hätte das Kindertheater in Erfurt einige Zeit weiterleben können. Furchtlos benennt Schmidt in seinem Buch "Theater, Krise und Reform" die fast obszöne Unverhältnismäßigkeit zwischen großen und kleinen Häusern: "Warum finanzieren Kommunen solche Luxusproduktionen, während sie an anderer Stelle heftige Kürzungen im kulturellen und soziokulturellen Bereich veranlassen?" Wie kann es sein, dass in Opernhäusern der Metropolen eine einzelne Vorstellung im Durchschnitt 250.000 Euro kostet – während ein Abend in einem Landestheater wie Anklam, Parchim oder Konstanz etwa 30mal günstiger ist und bis zu viermal mehr Menschen erreicht? Schmidt macht auch gleich einen Vorschlag: Von allen Produktionen, die über 50.000 Euro Kosten pro Vorstellung hinausgehen, könnten zehn Prozent abgezogen und umverteilt werden. Das ist nur ein Beispiel von konstruktiven und pragmatischen Klein-Reformen, die Schmidt in seinem Buch zu etwas fügt, was im Ganzen einer Theaterrevolution gleichen würde.
Krisendiagnose
Seine Krisendiagnose ist zunächst aber niederschmetternd: Während die Zuschauerzahlen stetig abnehmen, produzieren die Theater mit immer weniger Geld immer mehr und bleiben dabei in alten Strukturen erstarrt wie eh und je. Intendanten regierten mit absurd absolutistischer Herrschergewalt, mittlere Stadttheater zehrten sich an Tariferhöhungen auf, Kulturpolitiker agierten kopflos und Theaterkünstler rieben sich zunehmend auf.
Schmidt muss es wissen, von 2003 bis 2013 war er in der Leitung, ab 2013 Interimsintendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Dort setzte er mit Stephan Märki das sogenannte "Weimarer Modell" durch – ein erster Reformansatz, der im Wesentlichen daraus bestand, ein Hausvertrags-Tarifsystem zu verhandeln. Nicht ansatzweise ausreichend, sagt er selbst. Heute ist Schmidt Professor und Direktor des Studiengangs Theater und Orchestermanagement in Frankfurt/Main und beschäftigt sich täglich mit der Organisation von Kultur. Sein Buch liest sich zwar immer wieder wie ein Lehrbuch für professionelle Unternehmensführung, aber stellenweise auch spannend wie ein Krimi. Brutal und furchtlos listet er die perversen Auswüchse eines maroden Systems auf, der veralteten, autoritären Hierarchie-Struktur und schreckt dabei eben auch nicht vor Tabus zurück, indem er etwa das in Deutschland sakrosankte Prinzip des Repertoire-Betriebs in Frage stellt, ein "bald nicht mehr bezahlbarer Luxus", das die Kosten extrem in die Höhe treibe.
Der selbst gemachte Druck der Maschine Theater
Die Zuschauerrückgänge bewirkten, dass sich Theater zunehmend gezwungen fühlen, immer mehr zu produzieren. Mittlerweile haue jedes mittlere Theater in zehn Spielzeitmonaten bis zu 23 Produktionen heraus. Wurden 1995/96 von ca. 42.000 Theatermitarbeitern 57.000 Veranstaltungen gestemmt, waren es 2013/14 schon 74.000 Veranstaltungen mit nur noch 39.000 Mitarbeitern. Keine Zeit mehr zur Reflexion und wachsender Raubbau am künstlerischen Personal sind die Folgen. Kein Wunder, dass das neu gegründete Ensemble-Netzwerk immer stärker wird.
 Autor Thomas SchmidtVor allen Dingen aber tut Schmidt in seinem Buch, was etwa die Autoren des "Kulturinfarkts" einst versäumten: pragmatisch und konstruktiv stellt er acht Reformstränge und einen 40-Punkte-Plan vor, um das Theatersystem realistisch zu reformieren.
Autor Thomas SchmidtVor allen Dingen aber tut Schmidt in seinem Buch, was etwa die Autoren des "Kulturinfarkts" einst versäumten: pragmatisch und konstruktiv stellt er acht Reformstränge und einen 40-Punkte-Plan vor, um das Theatersystem realistisch zu reformieren.
Einer der Punkte ist sein Vorschlag, kollektiv aus dem öffentlichen Dienst auszutreten, um das ungerechte Mehrklassensystem an Theatern zu beenden. Ein weiterer: Der Abbau der grotesken Allmacht einzelner Intendanten, zugunsten von Team-Modellen und mehr Mitspracherechten des Ensembles. In einem Direktorium etwa könnte immer nur ein Leitungsmitglied ausscheiden, auch würde nicht stets aufs Neue ein Großteil des künstlerischen Ensembles ausgetauscht. Ein Mixed-Stagione-Prinzip, indem manche Produktionen länger am Stück gespielt werden statt des kostenintensiven Repertoire-Wahnsinns. Eine Organisation in der Rechtsform von Stiftungen. Verbindliche Honorarsysteme, um zunehmend explodierende Star-Gagen zu beschränken. Eine klügere Zusammenarbeit mit der Freien Szene, um ihr Innovationspotential zu nutzen. Vor allem aber plädiert Schmidt dafür, eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln, die dann das Vehikel für Reformen wäre, inklusive einer Eingangsprüfung der Theaterleitung sowie eines Leitbilds, auf das sich alle Theatermitarbeiter verständigen können: gut für Motivation und Atmosphäre am Haus.
Kunstfremde Begrifflichkeit
Schmidt scheut sich nicht, mit Begriffen aus der modernen Unternehmenspraxis zu operieren, das verlangsamt die Lektüre zuweilen, er empfiehlt "Change Management" und "Matrixorganisation" und stellt beide Prinzipien seitenlang vor – insgesamt eher kunstfremd wirkende Begriffe. Am Ende des über 400 Seiten langen Buches bleibt dennoch der Eindruck: Die grundsätzliche Reform des deutschen Stadttheatersystems ist eine Mammutaufgabe, die in kleinen Schritten machbar und unbedingt notwendig erscheint. Man kann da sicher Details kritisieren. Etwa, dass Schmidt eine genaue Analyse des Zuschauergeschmacks mit demographischer Analyse empfiehlt – und der Kunst ihre Kraft als widerständiges Medium gewissermaßen abspricht. Oder dass seine Argumente sich oft wiederholen, weil die einzelnen Reformbereiche ineinandergreifen. Auch wirkt seine Begrifflichkeit zuweilen äußerst durchökonomisiert. Hoch anrechnen muss man Schmidt aber, dass er seit langem schwelende und stets unlösbar erscheinende Probleme bündig zusammenfasst und seine Reformen konstruktiv und unkonventionell erscheinen, auch in Bereichen, die tabubesetzt sind. Es bleibt der Eindruck: Das Buch war überfällig. Es bietet eine konkrete Anleitung zur Erneuerung eines Systems, das sonst unwiderruflich todgeweiht ist.
Theater, Krise und Reform. Eine Kritik des deutschen Theatersystems
von Thomas Schmidt
Springer Fachmedien Wiesbaden 2017, 465 Seiten, 69,99 Euro
Mehr zur Debatte um das Theatersystem im deutschsprachigen Raum: Stephanie Gräve und Jonas Zipf fordern in ihrem Beitrag zur Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de eine Reform der Leitungsstruktur an Theatern aus dem Geiste der Mitbestimmung.