Andreas Wilink: Einar Schleef, eine Nacht in Wien - Ein Kapitel dem Buch "Aus der Fernnähe"
"Ich bin ein Anderer in mir, den muss ich fragen"
von Andreas Wilink
Einar Schleef, geb. 17. Januar 1944 in Sangerhausen, gest. 21. Juli 2001 in Berlin. Frühe Erfahrungen waren der Arbeiteraufstand 1953, die Flucht seines älteren Bruders aus der DDR, die eigene Sprachhemmung, zwei lange Krankenhausaufenthalte wegen Tuberkulose und nach einem schweren Unfall sowie die durch ihn vereitelte Flucht der Eltern kurz vor dem Mauerbau. Schon vor dem Abitur bestand er die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, die er trotz Relegation mit Diplom bestand. Er wurde Meisterschüler bei Karl von Appen an der Deutschen Akademie der Künste, Berlin. Ihm wurden Ausstattungen an Benno Bessons Volksbühne und am Berliner Ensemble der Ruth Berghaus anvertraut. Dort wird er zum Regisseur. Seine Strindberg-"Fräulein Julie" machte 1975 Skandal. Eine Projektvorbereitung in Wien brachte ihn 1976 dazu, nicht in die DDR zurückzukehren. Es bleibt bei schwierigen Arbeitsbedingungen, großen Theater-Pausen, Konflikten, Abbrüchen, Kündigungen. Parallel entstehen literarische Werke (darunter "Gertrud" und "Totentrompeten"). 1985 holte ihn Günther Rühle ans Schauspiel Frankfurt und hält zu ihm trotz heftiger Widerstände. In den 90-er Jahren folgten Inszenierungen u.a. am Berliner Ensemble, darunter "Wessis in Weimar", wiederum begleitet von Kontroversen mit Autor Rolf Hochhuth und den Co-Intendanten Peter Zadek (contra) und Heiner Müller (pro); ebenso drei Inszenierungen an Claus Peymanns Burgtheater, darunter die gefeierte fast siebenstündige Uraufführung von Elfriede Jelineks "Das Sportstück" (1999). Viermal wurde Einar Schleef zum Berliner Theatertreffen eingeladen.
Eine Nacht in Wien
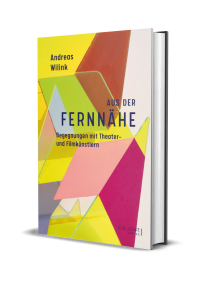 Eine halbe Nacht lang, im Sommer 1999 mit ihm durch Wien, von Lokal zu Lokal, wo der Kaffee, das Bier, die Wurst billig sind. Einar Schleef, den ich an der Haustür abgeholt hatte ("nee, nicht raufkommen") und der mir sogleich eine Plastiktüte mit allerlei Krempel zu tragen gab, sagte: "Sie laden mich aber ein!" Er wusste immer und überall, in den Wiener Bezirken wie in Harlem / NYC, wo die Preise niedrig sind oder es etwas fast umsonst gibt. Seinen eigenen Wert kannte er auch. Das Nachtgespräch, das nicht aufgezeichnet wurde in den lärmenden Gasthäusern, kam mir am nächsten Tag vor wie ein irre komischer Spuk oder ein Dada-Delirium. Allein, die Notizen im Spiralblock genügten für das Interview-Protokoll, das sich weiter unten findet und erstveröffentlicht wurde in der Westdeutschen Zeitung (8. Juli 1999).
Eine halbe Nacht lang, im Sommer 1999 mit ihm durch Wien, von Lokal zu Lokal, wo der Kaffee, das Bier, die Wurst billig sind. Einar Schleef, den ich an der Haustür abgeholt hatte ("nee, nicht raufkommen") und der mir sogleich eine Plastiktüte mit allerlei Krempel zu tragen gab, sagte: "Sie laden mich aber ein!" Er wusste immer und überall, in den Wiener Bezirken wie in Harlem / NYC, wo die Preise niedrig sind oder es etwas fast umsonst gibt. Seinen eigenen Wert kannte er auch. Das Nachtgespräch, das nicht aufgezeichnet wurde in den lärmenden Gasthäusern, kam mir am nächsten Tag vor wie ein irre komischer Spuk oder ein Dada-Delirium. Allein, die Notizen im Spiralblock genügten für das Interview-Protokoll, das sich weiter unten findet und erstveröffentlicht wurde in der Westdeutschen Zeitung (8. Juli 1999).
Der große Unzeitgemäße
Der Tod ist ein Scharfsteller, ist ein Hohn- und Wahrsager, wie auf den mittelalterlichen Totentänzen von Lübeck bis Basel. Als die Nachricht vom Herztod Schleefs, diesem Zentralorgan der Bühne, die Theaterwelt erreichte, stand ihr selbst einen Moment lang das Herz still. Zehn Tage hatte die Leiche nach dem Sterbedatum, dem 21. Juli 2001, unerkannt in einem Berliner Krankenhaus gelegen. Am heißesten Tag des Sommers wurde er in seiner Heimatstadt Sangerhausen, nicht fern vom Kyffhäuser, zu Grabe getragen. Eine "unglaubliche Metapher für dieses Leben", so der Publizist Harald Müller, für Schleefs Bekannt- und Verkannt-Sein sei dieser anonyme Tod gewesen. Der große Unzeitgemäße. In Schleef, dem Maler, Fotografen, Bühnenbildner, Theatermacher, Dramatiker, Essayisten, Prosa-Schriftsteller, Tagebuch-Schreiber, wurden Traum und Albtraum vom deutschen Menschen (und Übermenschen) Fleisch – von Faust und Luther bis Wagner, Nietzsche und Gerhart Hauptmann. In ihm, der 1976 die DDR verließ und in Wien, Frankfurt, Berlin wie im Wartestand lebte, bis er wieder Regie führte – das Antikenprojekt "Mütter", Goethes "Götz" und "Faust", später "Wessis in Weimar", die er am Berliner Ensemble aus Rolf Hochhuths Zettelkasten schüttelte und zum bildmächtigen Pamphlet umkomponierte – brach das deutsche und das deutsch-deutsche Leiden auf. Er war gleichsam in einem Klingsors Speer und Amfortas’ Wunde. "Und Amfortas steht in furchtbarer Ekstase – einsam", so Schleef in seinem Großessay "Droge Faust Parsifal".
"Weg mit der privaten Matsche", forderte Schleef von seinen Schauspielern auf Proben. "Das Denken muss kalt sein, sonst wird es familiär", schreibt Nietzsche. Indes, in seinen Aufzeichnungen verklemmen sich Drangsale des Persönlichen und Politischen, des Staates, der Familie und der Arbeit am Werk. Das Familiendrama wütete in dem Mann und Sohn, der randvoll von Biografie und Geschichte war: Mutter Gertrud, über die er ein obsessiv wahnwitziges Buch gleichen Titels schrieb, Vater Willy. Sangerhausen als geistige Lebensform, über die er (nie) hinauswuchs. "Wo ist meine Mutter?", notiert er einmal. Es bleibt eine zentrale Formel.
 "Salome" nach Oscar Wilde, Regie: Einar Schleef, Düsseldorfer Schauspielhaus 1997 © Ute Schendel
"Salome" nach Oscar Wilde, Regie: Einar Schleef, Düsseldorfer Schauspielhaus 1997 © Ute Schendel
In seinen Notaten rollen die Panzer am 17. Juni und maskieren sich die Lügen des Systems, während im Küchenmief ein Schmalzbrot geschmiert wird. Er fantasiert Gewalt, im Arbeiteraufstand, beim Mauerbau und scheiternden Fluchtversuch und am heimischen Herd, dem Schauplatz Hochschule und im Brecht-Ensemble. Zu sich selbst steht er in ständigem Widerspruch: er, der es liebt, sich auszutanzen, der auf "Abstand" hält, den die Sehnsucht bewegt und das Begehren quält, den ein Kuss "ekelt" und der konstatiert: "Es gibt kein Glück, keine Liebe, keine Wahrheit". Die Sprache Schleefs ist auch in seinen Sudelblättern und den Jahrzehnte später sie selbst kommentierenden, auch konterkarierenden und poetisierenden Nachträgen kurz und bündig, drastisch, humoresk, direkt, eigen: Fluss ohne Ufer, Sturzbach, Stromschnelle, Wasserfall. Als könnten die Gedanken nicht eilends genug Form finden; so wie, wenn er sprach, die Zunge in Unordnung geriet, die Buchstaben einander hemmten seit dem Unfall als Kind, der ihm die freie Rede raubte. Auf der Bühne war davon nichts zu merken. Da war er der Herr der Rede, war "Dynamit", war der Meister gestalteter Ekstasen und des von ihm seit den antiken Tragödien und Bachs Passionen aufgefundenen Widerstreits von Chor und Individuum, Arrangeur des Ornaments der Masse, rhetorisch brillant als Brechts Puntila und in Nietzsches "Ecce Homo"-Monolog während seiner letzten Aufführung "Verratenes Volk" am Deutschen Theater Berlin.
Produktive Verstörung lebte in dem monomanen Michelangelo der gewaltigen und gewalttätigen Sprech- und Sprachkörper, in seinen Inszenierungen, seinen Texten, seinem durch und durch musikalischen Sound. Aus ihnen schreit es: "Ich bin ein Anderer in mir, den muss ich fragen". So hat er die berühmte Rimbaud-Formel für sich umgemünzt.
Priester in Frack oder Uniformmantel
Vielfach begegnete ihm der absprechende Irrtum, er sei ein Wüterich, ein Berserker. Unfug. Schleef war fein, zart, altmodisch höflich. Er suchte den Gegensinn zu seiner elefantösen Körpermasse. Provokation lag höchstens in seinem Willen, mit dem er, der Wagnerianer, Rituale vollzog, Weihefestspiele stiftete, das Theater als Zeremonie und kontrolliertes Außer-Sich-Sein begriff. Das zivile Bürgerkleid, der Frack, oder der Uniformmantel waren seine Bühnen-Priestergewänder.
Schleefs im Juni 1997 am Düsseldorfer Schauspielhaus von ihm uraufgeführte, geschriebene und ausgestattete "Salome" war ein Sonderfall in seinem Bühnen-Werk. Nicht nur, weil er – anders als Oscar Wilde, der den biblischen Stoff ins Rankenwerk des Fin de Siècle geknüpft und die Sprache süß überstäubt hat – nahezu Prähistorie schuf: Mythenmaterial als Sprengstoff. Kein symbolisches Theater, sondern offensives und – seltsam genug – zugleich graziöses Sein. Brutal direkt wie ein Bildwerk von Francis Bacon. Die Verweigerung von metaphorischer Absicht machte Schleefs Theater ursprünglich groß.
 Einar Schleefs Düsseldorfer "Salome", 1997 © Ute Schendel
Einar Schleefs Düsseldorfer "Salome", 1997 © Ute Schendel
In der "Salome" setzte er an den Anfang einen 13-minütigen Prolog als stummes tableau vivant aller Mitwirkenden, darunter ein Chor alter Männer in schwarzen Roben. Nach diesem statischen Panorama senkte sich der Eiserne Vorhang wieder herab – zur Pause. Durch das große Pausenzeichen war der gewohnte Zeitbegriff entmachtet, bevor dann das Drama die krasseste Wendung nimmt und sich ins Extrem schraubt. "Der Tod hält Mahlzeit." Die Zäsur, die in der Durchbrechung der Aufführung lag, war auch in anderem Sinn eine: für Schleef, den Marathon-Mann des Theaters, der ein halbes Jahr später, im Januar 1998, am Burgtheater Wien Elfriede Jelineks "Sportstück" auf Langstrecke bringen würde. Hier nun war ein Wandel vom Oratorium zur Solo-Arie. Knapp und konzentriert und darin elementar, streng formalisiert und gleichwohl lodernd, funktioniert die "Salome" (ähnlich der Oper von Richard Strauss) scharf wie ein Fallbeil. Auf Messers Schneide. Kühn geführt über einen schmalen Steg, der die 60 Meter-Länge des Düsseldorfer Zuschauerraums bis zur Brandmauer in zwei Blocks teilte, balancierten auf metallischer Höhe die Protagonist(inn)en. Eine steile, absturzgefährdete Gratwanderung. Der Riss in der Welt, sichtbar gemacht.
"Salome, c’est moi"
In dem Prosa-Gedicht in einem Akt entfernt Schleef – weniger Übersetzer als Neuschöpfer – Oscar Wildes Garnitur, sprüht Gift, pflanzt Blumen des Bösen, die am Verkommenen Ufer unserer Spätzeit wachsen und die der Sturm der Geschichte knickt. Er schlägt das Drama aus dem Rahmen der Décadence und installiert es als End- und Passionsspiel, näher an Heiner Müller als am Bildner des "Dorian Gray". Pisse statt Parfüm. Schweiß und Blut und Samen. In seiner "Salome" entbrennt der fundamentalistische Kampf der Weltanschauungen. Konstruiert werden Antagonismen: Rom und Judäa, das Christliche, Jüdische und Heidnische, Patriarchat und Matriarchat, Staat und Sexus, Himmelsmacht und Totenreich, anarchischer Freiheitsanspruch versus faschistoider Ordnung. Das Stück stellt nicht allein die wilde Behauptung einer grandios grausigen Familien-Katastrophe auf, sondern die einer ideologischen Krise, in der christliche Leitkultur (trotz des erschlagenen Propheten und Vorgängers Christi) über die anderen Religionen bitter triumphiert. Und noch etwas darüber hinaus: die Evokation eines Sehnens, das sich nicht schert um soziale Einordnung und moralische Richtigkeit, das ein reguliertes Trieb-System verneint und Natur als nicht zähmbar ansieht. Der unbedingte Anspruch der Prinzessin wird frustriert durch das Unerreichbare ihres Begehrens: "Ich will Liebe, nicht Ehe", so dass ihre Revolte nach Blut schreit. Schleefs "Salome" zettelt zudem die biosoziale Debatte an über Mann und Frau, die zur Abdankung gezwungen wird von einer rabiaten männlichen (christlichen) Kultur.
Einar Schleef hätte sagen können: "Salome, c'est moi."
 Einar Schleef © Sonja Rothweiler
Einar Schleef © Sonja Rothweiler
"Der Westen ist doch eine große Ostzone"
AWI: Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was das Grundthema Ihrer Arbeiten ist: vielleicht die Beschäftigung mit der Deklassierung?
SCHLEEF: Wie meinen Sie das?
Etwa die Deklassierung des Einzelnen gegenüber der Gruppe – dem Chor, der Frau gegenüber dem Mann, der Archaik gegenüber der Zivilisation, Körper versus Kleidung, Osten versus Westen...
Entschuldigung, das hat sich nach der Wende doch vollkommen geändert. Den Westen gibt es nicht mehr. Der Traum der SED ist aufgegangen. Die DDR hat sich vergrößert. Es ist umgekehrt passiert: Alles eine große Ostzone.
Erklären Sie mir das bitte?
Wir sitzen doch hier auch auf dem Balkan. Ich bin extra mit Ihnen hierher in dieses Café gegangen. Wenn Sie das nicht sehen! Das sind doch die abgefuckten HO-Tischdecken, die da auf den Kunststoff-Tischen liegen.
Sie üben also nicht Kapitalismus-, sondern Kulturkritik? Argmentieren als Ästhet.
Nehmen Sie Berlin. Der Ku'damm verödet, der Osten wird aufgerüstet. Das ist der Geschmack des Ostens, alles. Der Trend überhaupt – klein, piefig, korrupt. Ich bin auf dem Potsdamer Platz und kaufe ein Stück holländischer Butter für 1,60 Mark, die trage ich dann im Triumph in den noblen Westteil, wo ich wohne.
Da ist die Butter teurer, die Reise hat sich folglich gelohnt.
Ich bitte Sie, wenn man die U- oder S-Bahnkarte hinzurechnet, hat sich gar nichts gelohnt.
Lassen wir mal die Butterpreise. Sind Sie für die Demokratisierung des Luxus?
Luxus, brauch' ich nicht. Ich komme vom Dorf. Die Welt hier habe ich nie angenommen.
Wenn ich Sie im Frack als Puntila und im "Sportstück" auf der Bühne sehe, denke ich: Ist diese Hülle die bürgerliche Form seines elitären Künstlertums?
Nein, die ist bei mir bestimmt nicht der Frack. Der ist eine Figur, für die Bühne. Der steht mir halt, bei meiner etwas dickeren Statur. In "Wessis" hatte ich einen Militärmantel an. Das war auch traumhaft. Wer kompakt ist, sollte eben nichts Unterteiltes tragen. Überhaupt sind alle Bühnenkostüme von mir doch sehr einfach.
In Ihren Äußerungen sind Sie bezwingend entwaffend, unmittelbar, durchlässig, wie ein Kind, niemals taktisch...
Wow! Das sind ja Gedankenchleifen! Ach, das weiß ich nicht. Ich bin nicht so kompliziert. (schweigt lange)
Ach? Sehen Sie, ich deute den Frack als strikte Ordnungs-Maßnahme, als Requisit zur Stabilisierung, nicht nur der des Körpers. Sind Sie als Künstler diszipliniert, planvoll in Ihrem Tagesablauf?
Nein, gar nicht organisiert, sondern chaotisch.
Aber man hat den Eindruck größter Produktivität. Sie arbeiten ständig mit sehr vorzeigbaren Resultaten.
Ich muss doch was vorweisen können. Aber die Hinlenkung auf die Arbeit hängt von vielen Zufällen ab. Den Traum, dass man Vincent van Gogh ist, hat man doch mit 18 schon aufgegeben. Insgesamt habe ich etwa zwei Jahre in New York verbracht. Da habe ich gearbeitet, draußen auf einer Bank. Da war ein Baum. Und wenn der Schatten wegging, wurde es zu heiß, dann bin ich gegangen. Da habe ich "Droge Faust Parsifal" und auch meine "Salome"-Fassung geschrieben.
In einem Filmporträt sieht man Sie durch Harlem laufen und wie Sie sich in Läden Devotionalien anschauen. Die Gretchenfrage, wie halten Sie's mit der Religion?
Meine gesamte Arbeit ist ja religiös. Jesus und das Christentum spielen eine große Rolle, weniger als Glaubensangelegenheit, vielmehr als Auseinandersetzung damit.
Also protestantisch, ganz auf sich selbst geworfen.
Eher noch ein bisschen strenger. Asketisch, so meine ich das.
Askese bedeutet auch Isolation. Fühlen Sie Ab- und Aussonderung als Ostmensch im Westen. Sie sagen: "Ich bin die Mauer. Gegen wen? Gegen mich selbst."
Im Osten nahm man es einfach nicht so genau. Da hatte man Frau und Kind und Hund und Kaninchen. Isolation ist doch eher ein Problem des hiesigen Menschen, nicht des Horden-Menschen aus dem Osten. Triebkraft und Freude hat man dort aus anderen Sachen gezogen. Die Sinnenfreude des Ostmenschen ist doch sprichwörtlich, nicht?
Und die bezog sich aus...
... aus dem Intimleben. Ganz sinpel und fertig. Askese und Sinnenfreude hängen eng zusammen. Man kann nicht arbeiten, wenn man durcheinander ist im Kopp.
Demnach eine positive Errungenschaft.
Ja. Logo. Um mit dem Alltag fertig zu werden. Man macht die Tür zu: Dahinter war dann meine Welt und nicht mehr der Staat. Die Versklavung in die Arbeit ist hier wesentlich größer. Privatleben muss man erkämpfen.
Sie sind sehr vital, abgehärtet, tanzen gern, schwimmen morgens in der Donau oder im Rhein. Tüchtig, der Mann. Überhaupt nicht der Chaos-Kopf.
Wissen Sie, das Problematisieren all dieser Dinge ist sehr schwierig. Morgens nach der Probe an die Donau zu gehen, sich auszuziehen und ins Wasser zu springen, ist es nicht.
Sie meinen, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, oder nicht doch eher umgekehrt, ein angeknackster Geist in einem gesunden Körper...?
Wenn ich nicht selbst massiv vorgehe und aktiv werde, passiert überhaupt nichts. Höchstens bei Frauen –
Würden Sie sagen, dass von Frauen grundsätzlich mehr Aktionismus ausgeht, mehr Energie, mehr Elan?
Ja, sicher (lange Pause). Entschuldigung, aber der rein heterosexuelle Mann ist doch ein Langweiler.
Was bedeutet in diesem Kontext auf Ihrer Bühne das männerbündische, uniformierte, auch das nackte, virile Bild. Homoerotische Ästhetik – Abwehr, Genuss, Ekel?
Auf der Bühne gilt: Anschauen ja, aber nicht anfassen.
Golo Mann sagte, Begehren nur aus der Distanz.
Ganz der Vater.
Aber nicht ganz der ältere Bruder. – Zurück zur weiblichen Energie. Ihre Frauen, nehmen wir Salome und Herodias, demnächst vielleicht in den geplanten Nibelungen Brunhild und Kriemhild, die sind oder die geraten, bei ihrer Stärke, in Situationen des Passiven.
Das sind eben auch Stücke, die handeln vom Ende der Frauenmacht. Irgendwann in ihrem Leben geschieht ein Unglück. Es passiert etwas ganz Schreckliches: dass man anfängt, zu lieben. Da kommt der Hammer.
Für mich handelt Ihre "Salome" wie auch Ihre Goldoni-Trilogie "Wilder Sommer", in der sie die Gleichung Geldwirtschaft = Geschlechtsverkehr aufmachen, im Innersten von den Demütigungen der Liebe.
(Zögert): Das kann ich nicht beantworten.
Gibt es eine Wegmarke, an der noch etwas zu retten wäre und an der sich noch zu retten wäre vor der Katastrophe Liebe?
(Zögert wieder): In den Kunstwerken ist es der Tod. Wie es im Leben ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch.
Ein gewisser trivialer Realitätssinn würde vermutlich einwenden, dass Sie die Macht des Schicksals gegenüber Möglichkeiten, vielleicht Notwendigkeiten der Selbstverantwortlichkeit überhöhen?
Wieso? Dann kommt man doch dazu zu sagen: Nutze das Kondom! Nehmen wir Siegfried und Kriemhild. Sehen Sie sich diese Idealpaare mal auf der Straße an, die sich nicht aushalten. Zunächst ist es toll, dann fällt der Putz ab. Kriemhild, die vernichtet von Anfang an. Im Intimverkehr ist die Abstoßung schon vorgegeben. Addio, Schnuppi!
So tarnt sich der Melancholiker, tarnt sich Resignation.
Ach, ach, ach... Darauf bauen ganze Wirtschaftszweige – der andere Mensch als das Tempo-Taschentuch.
Zewa-wisch-und-weg im Umgang miteinander? Jugend, Schönheit, Attraktivität als steriler Kult?
Und wie. Darauf baut doch die ganze schwule Kultur.
Welche Konsequenz ziehen Sie daraus?
Das Bauen der Gegenwelt. Tür zu! Das ist dann wieder Ostzone.
Aus der Sie doch raus sind. Die wollten und wollen Sie doch nicht.
Die hatte ich. Und habe ich in mir.
Im Westen setzen Sie sich krass anderen Erfahrungen aus.
Das ist das Drama des Einzelkämpfers.
Der Außenseiter und sein Rigorismus stoßen auf Befremden.
Nicht Rigorismus. Es ist ein anderes Denken, das bei mir verteufelt wird. Mithoppeln tun viele. Ich nicht.
Die Frage, Original-Genie oder Resteverwerter erübrigt sich bei Ihnen.
Das Denken verwertet keine Reste, es frisst sie auf.
 © Markus FegerDer Kulturjournalist, Theater- und Filmkritiker Andreas Wilink wurde 1957 in Bocholt geboren und lebt heute in Düsseldorf. Er war Redakteur der Westdeutschen Zeitung, kurz bei der Süddeutschen Zeitung, bevor er 2003 das NRW-Magazin kultur.west mitbegründet und bis 2018 geleitet hat. Wilink schreibt u.a. für den WDR, den Deutschlandfunk, für Theater heute und nachtkritik.de. Sechs Jahre war er Juror des Berliner Theatertreffens. Bei seinem Schleef-Text handelt es sich um ein Kapitel aus seinem Buch Aus der Fernnähe. Begegnungen mit Theater- und Filmkünstlern, das im Februar im C.W. Leske Verlag erscheint.
© Markus FegerDer Kulturjournalist, Theater- und Filmkritiker Andreas Wilink wurde 1957 in Bocholt geboren und lebt heute in Düsseldorf. Er war Redakteur der Westdeutschen Zeitung, kurz bei der Süddeutschen Zeitung, bevor er 2003 das NRW-Magazin kultur.west mitbegründet und bis 2018 geleitet hat. Wilink schreibt u.a. für den WDR, den Deutschlandfunk, für Theater heute und nachtkritik.de. Sechs Jahre war er Juror des Berliner Theatertreffens. Bei seinem Schleef-Text handelt es sich um ein Kapitel aus seinem Buch Aus der Fernnähe. Begegnungen mit Theater- und Filmkünstlern, das im Februar im C.W. Leske Verlag erscheint.
mehr bücher
meldungen >
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral



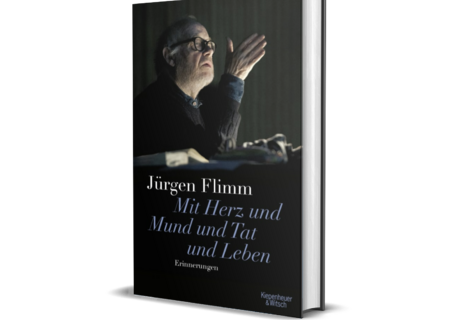









neueste kommentare >