Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen - Der Sammelband resümiert den Status Quo an deutschsprachigen Bühnen
Jenseits der Privilegien
von Esther Boldt
11. Juni 2019. Für wen ist Theater eigentlich da? Wer sind diejenigen, die ihre Geschichten und Themen auf die Bühne bringen, an welches Publikum richten sie sich und welches Selbstverständnis hat sie prägt? Es sind große, bohrende Fragen, die der Sammelband "Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen" stellt, veröffentlicht von der Dramaturgin und Kuratorin Elisa Liepsch, dem Aktivisten Julian Warner und von Matthias Pees, Intendant des Frankfurter Künstlerhauses Mousonturm. Aber diese Fragen sind ebenso wichtig wie notwendig. Das Buch entstand im Kontext der Festivalreihe "Afropean Mimicry and Mockery", die von 2014 bis 2016 am Mousonturm stattfand. Beschäftigten sich die Festival-Macher*innen zunächst mit dem deutsch-afrikanischen Austausch, so rückte immer stärker die Frage in den Blick, inwiefern Kulturinstitutionen permanent Strukturen reproduzieren, die weiße Künstler*innen und eine bestimmte, etablierte Ästhetik stets bevorzugen und andere Protagonist*innen ausgrenzen.
Alltägliche Rassismen
In "Allianzen" berichten Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Theaterschaffende nun umfassend von diesen Ausgrenzungen, von Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen, die sie vonseiten der Kulturinstitutionen, aber auch im Alltag erfahren haben: Sie berichten von einer mehr oder minder subtilen Form des Rassismus, die viel mit Ignoranz zu tun hat, mit einer nicht – oder nur sehr zögerlich – stattfindenden Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit etablierten, für selbstverständlich genommenen Machtstrukturen.
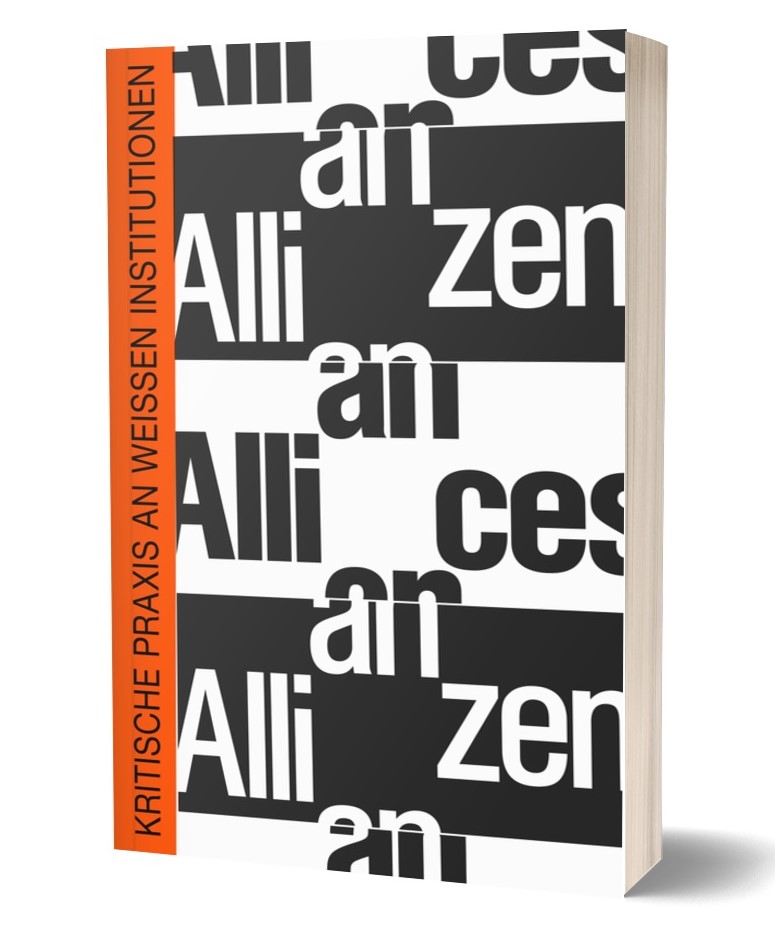 Damit knüpfen die Autor*innen an postkoloniale Denker*innen wie Homi K. Bhabha, Edward Said, Frantz Fanon und Gayatri Spivak an, die nachgewiesen haben, dass koloniale Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung der modernen Welt waren und dass die über Jahrhunderte gewachsenen Machtstrukturen noch heute, knapp 60 Jahre nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien, Wirkungen zeigen.
Damit knüpfen die Autor*innen an postkoloniale Denker*innen wie Homi K. Bhabha, Edward Said, Frantz Fanon und Gayatri Spivak an, die nachgewiesen haben, dass koloniale Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung der modernen Welt waren und dass die über Jahrhunderte gewachsenen Machtstrukturen noch heute, knapp 60 Jahre nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien, Wirkungen zeigen.
So beschreibt die Regisseurin Anta Helena Recke in "Uh Baby it’s a White World" die Widerstände, lapidaren Respektlosigkeiten und persönlichen Herabwertungen, mit denen sie es in den Münchner Kammerspielen zu tun bekam, als sie dort Mittelreich probte – und sich beispielsweise wiederholt mit der Frage konfrontiert sah, ob denn ein schwarzer Chor überhaupt Brahms singen könne. Recke erlebte am Haus alle denkbaren Haltungen zu dem Projekt, aber am schwierigsten fand sie es, dass sich einige nicht vorstellen konnten, dass schwarze Profis das gleiche machen und leisten können wie weiße. Die Regisseurin endet mit dem Fazit: "Als Schwarze Frau bin ich kein universelles Subjekt, meine Perspektive bleibt immer verhandel- oder streitbar, während die eines weißen Mannes fast automatisch mit genau dem richtigen Hauch von 'faktenbasierter' Neutralität und Objektivität versehen ist."
Für welche Gesellschaft?
Die Erfahrung, dass die eigene Position quasi prinzipiell verhandelbar ist, dass professionelle Kompetenz, aber auch kritische Rückfragen und Beobachtungen permanent infrage gestellt werden, teilen bestürzenderweise alle Autor*innen. Auch kommen viele Beiträge darauf zu sprechen, dass rassistische Bilder und rassistische Sprache in Inszenierungen wiederholt werden und ihnen also zu immer neuer Aktualität verholfen wird. Hiergegen wandte sich unter anderem seit 2011 das Bündnis Bühnenwatch. So heterogen unsere Gesellschaft heute sei, das Theater adressiere immer noch ein weißes Publikum, so die Analyse der afrodeutschen Regisseurin und Performerin Simone Dede Ayivi: "Dass Schwarze Protagonist*innen im Theater hauptsächlich in internationalen Ensembles […] präsent sind, verfestigt wie gesagt das Bild von weißen Deutschen und Schwarzen Ausländer*innen."
Ziel solle es aber sein, dass schwarze Menschen sich als selbstverständlicher Teil einer Gesellschaft sehen, auch als solcher anerkannt werden und sich mit eben diesem Selbstverständnis auch im Theater wiederfinden. Wer glaubt, dass die Diskussionen der vergangenen Jahre nicht nur Bewusstsein geschaffen, sondern auch echte Veränderungen erzielt haben, den holt das Buch auf den Boden der Tatsachen zurück: Von diesem Selbstverständnis sind wir immer noch weit entfernt. Zwar werden die Ensembles diverser, aber in den Dramaturgien und Führungspositionen bleiben die Theater weiß und die PoC-Spieler*innen dadurch "Quoten-Diverse".
Identitätsverwirrung
"Allianzen" macht allerdings auch klar, warum die Kritik an bestehenden Praxen vielerorts auf taube Ohren stößt: Von Seiten weißer Protagonist*innen und Kulturinstitutionen müsste die Existenz tiefgreifender Privilegien und Ungleichheiten eingeräumt werden und damit würde vieles, was als selbstverständlich gilt, in Frage stehen.
Analog zu Judith Butlers Gender Trouble lässt sich hier von einem Taumel der Identitäten sprechen: Die Wissenschaftlerin Nana Adusei-Poku beschreibt in ihrem höchst lesenswerten Essay "Everyone Has to Learn Everything or Emotional Labor Rewind" die Identitätskrise, die bei ihren Studierenden die Erkenntnis des eigenen Weißseins hervorruft: "One oft he biggest fears that I encoutner in the classroom is a loss of a sense of self, when students realize their priviledges." Die Erkenntnis der über Generationen historisch gewachsenen gesellschaftlichen Position ist identitätsgefährdend, die entstehenden Widerstände sind evident.
Kritische Praxis
Über die kritische Bestandsaufnahme hinaus versammelt "Allianzen", das sich explizit als Praxis- und Handbuch versteht, Vorschläge – oder, wie die Herausgeber*innen es forscher formulieren: konkrete Handlungsanweisungen. So entwerfen Ewelina Benbenek, Nadine Jessen und Elisa Liepsch das Modell einer radikal anders konzipierten, einer "solidarischen Institution", die bereit ist, die "eigenen, westlichen und überwiegend biodeutschen Strukturen" kritisch zu reflektieren. Zudem soll diese solidarische Institution ihre Mittel nutzen, um diese Strukturen zu verändern und eine breitere Teilhabe zu schaffen, um unter anderem nicht-deutsche Künstler*innen stärker zu fördern und sie beispielsweise bei Visa-Schwierigkeiten und alltäglicher Diskriminierung (wie häufigeren Polizeikontrollen) besser zu unterstützen.
So unkomfortabel die Lektüre bisweilen ist, weil sie das Selbstbild deutscher Kulturinstitutionen als per se links, kritisch und zukunftsgewandt infrage stellt, "Allianzen" ist ein höchst lesenswertes, vielstimmiges Buch, das strukturelle Schieflagen in den Institutionen eindrücklich markiert und somit die Möglichkeit gibt, diese zu reflektieren und zu verändern.
Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen
Elisa Liepsch, Julian Warner, Matthias Pees (Hg.), Transcript 2018, 304 S., 17,99 Euro
Zum Weiterlesen und -hören empfiehlt Esther Boldt: Matthias Dells Kritik an der Rezeption von "Mittelreich" auf Spiegel online.
Reni Eddo-Lodge: Ausgeschlossen vom Menschsein auf Zeit.de im Januar 2019, "The black, African, female, body" von Nora Chipaumire at TEDxCalArts und Chimamanda Ngozi Adichies "Die Gefahr einer einzigen Geschichte".
meldungen >
- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral
- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"
- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben
- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant








neueste kommentare >