Kolumne: Als ich noch ein Kritiker war - Wolfgang Behrens fragt sich, was hinter der Regiseur*innen-Behauptung steckt, dass sie keine Kritiken läsen
Nie, nie, nie
von Wolfgang Behrens
5. Februar 2020. Als ich noch ein Kritiker war, kam in den Redaktionen, in denen und für die ich tätig war, immer mal wieder die Frage auf, für wen man denn eigentlich seine Kritiken schreibe. Und die Antwort lautete regelmäßig: für den Leser schreibe man, womöglich auch für die Leserin, jedenfalls fürs Publikum. Auch der geschätzte Kollege Michael Wolf ließ sich vor einigen Wochen in seiner Kolumne dahingehend vernehmen, als er forderte: "Mehr als dem Kunstwerk ist der Kritiker den Lesern, dem Publikum verpflichtet."
Abholen oder Nicht-abholen?
Bei dieser Erkenntnis jedoch blieb man meist nicht stehen, vielmehr schlossen sich oft Überlegungen an, wie denn dieses Publikum wohl beschaffen sei: Ist es vornehmlich eines aus Fachleuten, oder ist es eines, das sich dem Theater weitgehend voraussetzungslos nähert? Und wenn solche Spekulationen gänzlich ins Kraut schossen, dann konstruierte man sich gerne eine Art Leser*innen-Popanz, den man – um meine Lieblingsformulierung aus solchen Diskussionen zu gebrauchen – "dort abholen müsse, wo er steht" (als ob irgendjemand wüsste, wo irgendjemand stünde).
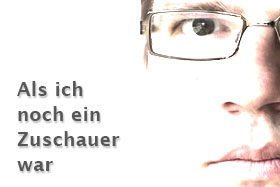 Es gipfelte im schlimmsten Fall in Regeln, wie für solchermaßen erdachte Leser*innen zu schreiben sei: möglichst einfach zum Beispiel, in Sätzen, die lieber aus drei als aus acht Wörtern bestehen. ("Der Vorhang geht auf. Ödipus kommt. Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer spielt ihn. Er läuft gegen eine Wand. Das Publikum kichert.")
Es gipfelte im schlimmsten Fall in Regeln, wie für solchermaßen erdachte Leser*innen zu schreiben sei: möglichst einfach zum Beispiel, in Sätzen, die lieber aus drei als aus acht Wörtern bestehen. ("Der Vorhang geht auf. Ödipus kommt. Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer spielt ihn. Er läuft gegen eine Wand. Das Publikum kichert.")
Seltsamerweise waren die einzigen Leser, an die ich ab und an beim Schreiben dachte, als ich noch ein Kritiker war, nicht diejenigen aus dem Publikum, sondern die jeweiligen Künstler*innen, über die ich schrieb. Und von daher stammte auch die einzige Regel, die ich akzeptierte. Es gab eine Art empathisches Kriterium, das ich einzuhalten suchte: Sobald sich bei mir das Gefühl einstellte, ich würde das, was ich gerade niederzuschreiben im Begriff war, dem- oder derjenigen nicht auch direkt ins Gesicht sagen können, formulierte ich es anders.
Verlorene Liebesmüh
Ich war und bin in solchen Fällen auch gegenüber anderen Kritiker*innen streng und neige dazu, mich über eine bestimmte Art von Pauschalurteilen aufzuregen. Ein Kollege schrieb etwa einmal über einen Schauspieler, er sei "deprimierend ausstrahlungsarm" – meines Erachtens wird da eine Grenze überschritten, weil nicht mehr über eine Rollendarstellung verhandelt, sondern ein Mensch derart abgeurteilt wird, dass es an die Grundlagen seiner Existenz geht. Das ist keine Kritik mehr, das ist Dieter Bohlen (und das würde ich Dieter Bohlen genau so ins Gesicht sagen können). Michael Wolf übrigens stellte in seiner bereits zitierten Kolumne auch den Satz auf: "Es ist nicht förderlich, wenn Kritiker zu stark die Perspektive der Produzenten einnehmen." Ich würde dem entgegenstellen: Es ist nicht förderlich, wenn die Perspektive der Produzent*innen gänzlich außer Acht gelassen wird.
Seit ich am Theater arbeite, weiß ich allerdings, dass mein empathisches Kriterium verlorene Liebesmüh war. Denn kaum einen anderen Satz habe ich seitdem so häufig gehört (und von Regisseur*innen noch häufiger als von Schauspieler*innen) wie: "Ich lese grundsätzlich keine Kritiken." Anfangs war ich von dieser Haltung entsetzt, mittlerweile kann ich sie ganz gut nachvollziehen: Die Künstler, die sich gegen das Lesen von Kritiken entscheiden, wollen sich vor Formulierungen wie der oben angeführten schützen, die sich gewissermaßen wie eine Beschmutzung der eigenen Arbeit und der eigenen Person anfühlen. Da einer Rezension nicht von vornherein anzumerken ist, ob sie einen fairen Diskurs sucht oder ob sie auch verletzende Bereiche berührt, lässt man sie lieber gleich links liegen.
Das rätselhafte Andere
Wobei längst nicht entschieden ist, wie viel Koketterie bei der Behauptung, keine Kritiken zu lesen, im Spiel ist. Das erste Mal hörte ich sie übrigens von dem (vor drei Jahren leider verstorbenen) Regisseur Ernst M. Binder – nebenbei ein Mann, der das komplette Gegenteil des Attributs "deprimierend ausstrahlungsarm" verkörperte. Ich traf mich mit Binder in einem Café am Hackeschen Markt in Berlin, weil er für "Theater der Zeit" (die Zeitschrift, für die ich damals arbeitete) einen Text beisteuern wollte. Nachdem er mir versichert hatte, dass er nie, nie, nie Kritiken lesen würde, sprachen wir über seine Schweriner Uraufführung des dritten "Totentrompeten"-Stücks von Einar Schleef. Und irgendwann sagte er: "Ach ja, Du hast ja damals in Deiner Kritik meinen Choreinsatz kritisiert." Ach so? Aber Du liest doch gar keine Kritiken? "Na, das ist etwas Anderes", sagte er. Und lachte. Was aber das Andere war, habe ich bis heute nicht erfahren.
Wolfgang Behrens, Jahrgang 1970, ist seit der Spielzeit 2017/18 Dramaturg am Staatstheater Wiesbaden. Zuvor war er Redakteur bei nachtkritik.de. Er studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Mathematik in Berlin. Für seine Kolumne "Als ich noch ein Kritiker war" wühlt er unter anderem in seinem reichen Theateranekdotenschatz.
Zuletzt schrieb Wolfgang Behrens über das seltsame Ritual des Schauspieler*innen-Vorsprechens.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.





