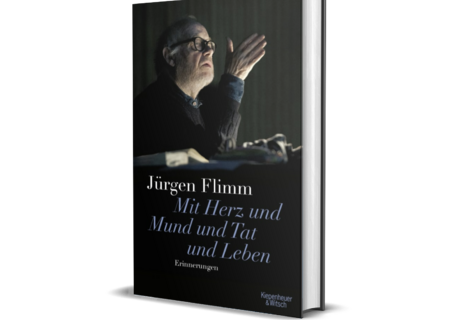Fritz Marquardt. Wahrhaftigkeit und Zorn, Hrsg. Michael Laages und Wolfgang Behrens, Berlin 2008
Castorf stößt verdienten Regisseur Treppe hinunter
18. November 2008. Die Anekdoten über ihn sind Legion. Ob er mit Kohlen auf Verwaltungsdirektoren warf, auf "Woyzeck"-Proben mit Georg Büchner persönlich sprach oder von Frank Castorf eine Treppe hinuntergestoßen wurde – immer geht es in diesen Geschichten ums Ganze. Ums Ganze des Theaters und ums Ganze des Lebens.
Schauspieler wie Corinna Harfouch oder Winfried Glatzeder und den Regisseur Dimiter Gotscheff prägte er maßgeblich. Angelica Domröse, Jürgen Gosch, Rolf Boysen oder Martin Wuttke spielten in seinen Inszenierungen. Und er hat legendäre Heiner-Müller-Erstaufführungen verantwortet. Und doch ist er – zumal im Westen – einer der großen Unbekannten des DDR-Theaters geblieben: Fritz Marquardt.
Für das Buch "Fritz Marquardt. Wahrhaftigkeit und Zorn" haben sich Michael Laages und Wolfgang Behrens zwischen März 2006 und Januar 2008 von Fritz Marquardt sein ebenso exemplarisches wie inkommensurables Leben erzählen lassen, das vom Gefangenenlager in Sibirien über die Erdölraffinerie Schwedt/Oder bis in die Leitungsetagen der Volksbühne und des Berliner Ensembles führt. Flankiert werden diese Gesprächsprotokolle von zahlreichen Beiträgen, die u.a. von Corinna Harfouch, Hermann Beyer, Frank Castorf, Thomas Heise, Dimiter Gotscheff, Stephan Suschke und B.K. Tragelehn stammen.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Theater der Zeit veröffentlichen wir im Folgenden zwei Auszüge, im ersten lernt Fritz Marquardt Anfang der sechziger Jahre in Ostberlin einen Dramatiker kennen, der gerade in Ungnade gefallen ist. Im zweiten Abschmnitt trifft er in den toskanischen Bergen auf einen Großregisseur, der ihn für einen Ureinwohner Australiens hält.
(jnm/ wb)
Fritz Marquardt lernt Heiner Müller kennen
Von 1959 ist 1961 ist Fritz Marquardt Redakteur bei der Zeitschrift "Theater der Zeit", nachdem er vorher ein Jahr lang als Maurer auf der Großbaustelle des Erdölwerks in Schwedt/Oder tätig war.
Das zentrale Ereignis dieser Jahre war für mich die berühmt-berüchtigte Studentenaufführung von Heiner Müllers "Die Umsiedlerin" in der Regie von B.K. Tragelehn, an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst, die dann verboten wurde und zu massiven Problemen für Müller und Tragelehn führte.
"Die Umsiedlerin" zeigt ja – wie der Untertitel schon sagt – "Das Leben auf dem Lande". Und das war das Leben, das ich in den 40er Jahren selbst noch gelebt habe. Ich bin sogar zwei Jahre lang Bauer gewesen – mein Vater war verunglückt, und ich habe danach die Neubauern-Wirtschaft der Eltern geführt. Und diese Kombination – also einerseits meine Erfahrung in der Landwirtschaft, meine Ausbildung auf der anderen Seite – bedingte meine Meinung über "Die Umsiedlerin", die ich als äußerst überzeugend empfunden habe.
Ich habe aber über "Die Umsiedlerin" in "Theater der Zeit" nicht geschrieben, nicht schreiben dürfen. Ich habe sie später mal in einem Aufsatz erwähnt und – was für ein Blödsinn! – behauptet, dass da etwas mit der Dramaturgie nicht stimme. Das wurde dann dummerweise immer wieder zitiert – und ich auf diese Weise fälschlich zum Gegner der "Umsiedlerin".
Nach der "Umsiedlerin" dachte ich, wenn man jetzt sofort zu Heiner Müller hinläuft, hilft man ihm nicht, sondern macht nur sich und andere verdächtig. Ich wusste natürlich, wenn jemand sich so in die Scheiße geritten hatte, wird er auch beobachtet. Wenn ich gewusst hätte, was ich ihm außer meiner Hochachtung hätte sagen können, wäre ich vielleicht doch hingegangen. Aber so!
Wirklich kennengelernt habe ich Heiner dann erst, als die Situation schon wieder entspannter war – an einem Abend, an dem Tragelehn bei sich zu Hause aus dem "Bau" gelesen hat. Ich bin da – von einem auch vom Alkohol hochgetriebenen Unwillen befallen – ziemlich ausgerastet: Das schien mir eine Art hochgeschossene Großkacke; da wurde das, was auf dem Bau passiert und wie ich es in Schwedt erlebt habe, in eine ungeheuer pathetische Form gebracht. Ich hatte die Wirklichkeit von Schwedt noch zu stark im Kopf, als dass sich mir das Pathos der "Bau"-Metapher hätte erschließen können. Die dargestellten Vorgänge und die sprachliche Form gingen meines Erachtens keine Korrespondenz miteinander ein.
Ich habe Tragelehn, dessen Stückfragment "Die Aufgabe" ein Vorbild für Müller war – was ich damals nicht wusste –, ich habe Tragelehn also als Obermaurer verspottet und andere Dinge. Und plötzlich steht Müller in der Tür – wie ein Gespenst. Das war der markante Moment, in dem unsere Freundschaft begann: Müller kam in die hochgeheizte Stimmung hinein, blieb sehr gelassen, fragte, was los sei, und verabredete sich mit mir.
In der Folge bin ich sicher in ganz wesentlichen Punkten, in meinen Grundansichten von ihm beeinflusst worden. Bis dahin hatte ich ja nur so eine Wald- und Wiesenästhetik, ein bisschen Lukács und was man sich so zusammengedacht hat, aber für eine wirklich praktische Theater-Ästhetik war das nicht brauchbar. In den Gesprächen mit Heiner konnte sich das dann entwickeln.
Mein Vorbehalt gegen "Bau" war ja ein recht dumpfer gewesen: Es sei darin alles scheußliche Schönfärberei. Wenn der "Bau" nicht auf eine andere Weise zu verstehen gewesen wäre, als ich ihn damals sah, hätte ich ihn natürlich 1980 an der Volksbühne nicht selbst inszeniert. Das Produktionsstück interessiert einen Dreck; was interessiert, ist ein Grundvorgang.
Wenn man den "Bau" nicht als große Metapher versteht, sondern von den Realitäten her argumentiert, macht man etwas falsch. Deshalb bin ich in meiner Inszenierung gleich weg von jeglicher Abbildhaftigkeit. Trotzdem bin ich nie ganz glücklich geworden mit dem "Bau". Auch mit dem Film "Spur der Steine" (1966) von Frank Beyer mit Manfred Krug, dem ja derselbe Stoff zugrunde liegt, hatte ich immer meine Schwierigkeiten.
Was mich am "Bau" darüber hinaus beschäftigt, ist die Frage, inwieweit seine Metapher mit der Kommunismus-Utopie zusammenhängt. Die "Bau"-Metapher hat doch wahrscheinlich nur einen Sinn, wenn sie auf irgendeine dauerhafte gesellschaftliche Lösung hinzielt. Wenn man die fallen lässt, kann man den "Bau" eigentlich nicht spielen. Und als ich das Stück 1980 inszenierte, muss es die Leute noch bewegt haben, sonst wären sie nicht wie verrückt in die Vorstellungen gegangen – in der letzten Aufführung saßen sie noch auf den Treppen.
Ursprünglich war ich ja auf "Germania Tod in Berlin" aus gewesen. Dass dann "Der Bau" kam, das lag an Müller selbst, der meinte, "Bau" sei heute wichtiger als "Germania". Vielleicht war das aber auch einfach die schlitzohrige Überlegung des Autors, dass das die letzte Möglichkeit sein könnte, den "Bau" zu spielen, während die Zeit von "Germania" noch kommen würde.
Stimmt ja nicht ganz, denn auch Thomas Heise hat den "Bau" sogar 1996 noch einmal am Berliner Ensemble gemacht. Heise entwickelte in dieser Inszenierung eine regelrecht kindliche Freude, während ich mich manchmal fragte, was der Quatsch solle, wenn die dann auf der Bühne rumhüpften und Lipsi tanzten. Es gab da keinen Griff nach irgendetwas.
Wobei ich auch zugeben muss, dass es mir schwer fällt, die Qualitäten einer anderen Arbeit zu sehen – falls sie nicht verteufelt gut ist! –, wenn ich das Stück einmal selbst inszeniert habe.
Ob man ein Stück wie "Bau" heute noch spielen könnte, das kann man nur beantworten, indem man sich hinsetzt und Satz für Satz liest und prüft, wie sich der Text heute anhört und was daraus folgt. Vielleicht stellt sich heraus, dass er nur eine grässliche Farce ist, doch vielleicht auch etwas anderes. Für Heiner aber war "Der Bau", nachdem er einmal geschrieben war, wohl nicht mehr wiederholbar, nicht mehr fortsetzbar, weil danach wohl auch der letzte Rest von Kommunismus-Utopie aus seinem Hirn entwich. Jedenfalls haben wir uns über die Frage der Kommunismus-Utopie danach nicht mehr unterhalten.
Rückblickend vermute ich ohnehin, dass diese Frage eher eine religiöse Frage ist. Sie als Religion abzutun, ist natürlich auch eine Selbstbezichtigung – so dumm gewesen zu sein, an der Utopie festzuhalten, kann ich auch heute nicht bedauern –, aber mittlerweile fehlt mir jeder Glaube. Sicherlich ist es leichter gewesen, an die Utopie zu glauben mit der Existenz der DDR als nur mit dem Schlachtruf: "Wieder dasselbe, nur dieses Mal besser." Vielleicht ist die Weltgeschichte aber auch so: Immer dasselbe, und jedes Mal ein bisschen schlechter.
Ich hatte mit Heiner, der für mein Denken ja eine grundsätzliche ästhetische Wende bedeutete, immer wieder Streitigkeiten. So wollte er mir z.B. immer in stundenlangen Ringkämpfen Thomas Mann austreiben, den er – da ganz aus der Brecht-Schule kommend – als bürgerlich wahrnahm. Über "Doktor Faustus" oder "Zauberberg" ließ ich aber nicht mit mir reden: "Tut mit leid", sagte ich, "das sind große Bücher!" Und er fand wunderbare Argumente, um einem das zunichte zu machen. Zu meinem Erstaunen habe ich dann aber auch gesehen, dass Heiner später diese Streitigkeiten mit mir sehr gescheit genützt hat, etwa in seinen Reden in Amerika über "Doktor Faustus".
Fritz Marquardt lernt Peter Zadek kennen
Seit 1985 ist Fritz Marquardt fest als Regisseur am Berliner Ensemble und erlebt dort die Querelen um die Neubesetzung der Intendanz nach der "Wende".
Dass es ab 1992 eine Leitung am Berliner Ensemble mit fünf Personen – mit Heiner Müller, Peter Zadek, Peter Palitzsch, Matthias Langhoff und mir – gab, das ist meines Erachtens eine Erfindung von Ivan Nagel, auf die sich Roloff-Momin [Anfang der 90er Jahre bekleidete Ulrich Roloff-Momin, zuvor Präsident der Hochschule der Künste, die Position des Berliner Kultursenators – d. Red.] total verlassen hat. Wir hatten uns in dieser Konstellation noch nie getroffen. Dann kam – irgendwann in den Theaterferien – Renate Ziemer, die Heiners Privatbüro führte, zu mir in die Uckermark raus und sagte: "Nächste Woche musst du nach Lucca. Zu Peter Zadek." - "Ich denke gar nicht daran, ich habe Ferien. Wenn Herr Zadek mit mir reden will, kann er ja nach Berlin kommen."
Ein paar Tage später war Heiner da, das einzige Mal übrigens, das er in meinem Haus in der Uckermark gewesen ist. Er hat drei Stunden lang mit mir geredet. Danach wusste ich, dass ich nach Lucca fahren werde.
Die Reise nach Lucca ging total schief. Unterwegs hat Müller angefangen Whiskey zu trinken, und ich habe das mitgemacht. Ich vertrage keinen Whiskey, war aber nicht zu belehren und habe immer in Gegenwart von Müller Whiskey getrunken, bis irgendetwas Fürchterliches passierte.
Wir wurden von Langhoff am Flughafen in Pisa abgeholt und fuhren in die Berge auf Zadeks herzoglichen Sitz, eine schlossartige Villa. Ich war bei der Ankunft ein bisschen – na ja! Peter Palitzsch schreibt darüber in seinen Erinnerungen: "Beim Eintreffen von Marquardt reagierte Zadek auf den fremden Ankömmling wie auf einen Ureinwohner Australiens." Das trifft es. Ich wäre sofort wieder gegangen, wenn ich gewusst hätte, wie ich da wieder wegkomme – wir waren ja zwei Stunden in die Berge hineingefahren. Wir sind zwei Tage dort geblieben, ich hatte aber keine Lust mehr, viel zu sagen. So verlief unser erstes Treffen. […]
Meine nächste Inszenierung war ein O’Casey: "Juno und der Pfau". Während der Arbeit an "Juno und der Pfau" kam Zadek eines Tages mit seiner Assistentin in die laufende Probe rein, setzte sich vorne in die zweite Reihe und gab hörbar Kommentare. Die Lähmung, die dadurch in den Raum kam, kann man sich vorstellen. Und das Seltsamste ist: Ich stehe nicht auf und gehe! Wenn Wekwerth sich da hingesetzt hätte, keine zwei Minuten wäre ich im Raum geblieben. Ich weiß nicht, welche Erstarrung mich da hat sitzen lassen.
Palitzsch hat bei den letzten Begegnungen in seiner wunderschönen Villa in Havelberg mal erzählt, dass er mit Zadek ähnlich fürchterliche Erlebnisse gehabt hatte: Wo er rigoros in seine Inszenierungen reingeredet und reininszeniert hat, dass also auch er tief verletzt worden ist durch Zadek. Ich konnte so etwas aber obendrein nicht ertragen, ohne mich sozial getroffen zu fühlen. Als Kretin. Oder Ureinwohner Australiens.
In einem Punkt war ich immer absolut scharf, das sagen auch die Schauspieler – wenn es um die Bühne ging, benahm ich mich in einer Art und Weise, wie sie es nicht erwartet hätten: Rigoros. Und das war nun eine Situation, wo die Schauspieler da waren, und ich hab’ mir das gefallen lassen. Ich kann es mir nur so denken: Dass das ganze Gebäude, was ich im Kopf hatte, und das ja auch etwas zu tun hat mit meinem Marxismus-Studium, gelähmt war bis zum Nicht-mehr-Nachdenken.
Es bedingt dann eines das andere, da ja alles immer in Bewegung ist: Eine Probe funktioniert nicht, das drückt auf das ohnehin angeschlagene Selbstbewusstsein, und dann kamen ständig die Blicke von Zadek hinzu. Wie er mich gesehen haben muss, zeigte sich, als er mich in seiner Inszenierung "Das Wunder von Mailand besetzen wollte. Da gibt es eine Figur – die mickrigste Figur, die es in dem Stück gibt: den Hühnerfresser. Drei- oder viermal hat mich Zadek angesprochen, ob ich nicht diese Rolle spielen wollte. Ich habe ihm abgesagt, weil ich keine Zeit gehabt hätte bei den Proben zu sein – was ihn nicht gestört hätte: "Macht nichts! Das machen wir so nebenbei!" Was ich nicht wollte. Erst später habe ich kapiert, dass das das Bild war, das er von mir hatte: Der miese Typ, der alles macht und nebenbei Hühner frisst.
Aus: Fritz Marquardt. Wahrhaftigkeit und Zorn.
Hrsg. von Michael Laages und Wolfgang Behrens.
Berlin: Theater der Zeit 2008.
191 S., 18 Euro.