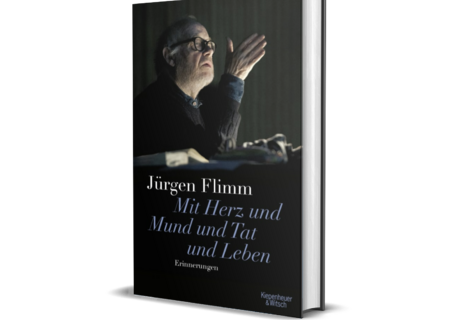Barbara Gronau, Alice Lagaay (Hg.): Performanzen des Nichttuns, Passagen Verlag, Wien 2008
Yes, we can't
von Esther Boldt
11. März 2009. Die Theaterwissenschaft ist eine große Erfinderin. Die Begriffsschöpfung hat hier Tradition, das Umkreisen ihres Gegenstandes aus immer neuen Richtungen und Blickwinkeln, unter der Ausprägung von stets neuen Begrifflichkeiten. "Performanzen des Nichttuns" heißt ein Sammelband, der wieder einmal eine neue Sichtweise begründen soll und von Barbara Gronau und Alice Lagaay, Mitarbeiterinnen des Sonderforschungsbereichs "Kulturen des Performativen" an der Freien Universität Berlin, herausgegeben wurde.
Sie möchten den 'umbrella term' der Performanz kritisch reflektieren und erweitern, der, von John L. Austin 1961 in die Welt gesetzt, eine beachtliche Karriere in den Geisteswissenschaften hinlegte. Als Performanz bezeichnete der Linguist die Realitäts-erzeugende Wirkung der Sprache, gerade in Form gesellschaftlicher Rituale und Konventionen.
Die Rückseite des Tuns
In der Theaterwissenschaft fiel diese Rückbindung von Ritual und Aufführung, Sprache und Verkörperung auf fruchtbaren Boden. Barbara Gronau und Alice Lagaay haben das "Denken des Performativen" jedoch im Verdacht, einseitig zu sein, auf die "Tätigkeiten des Produzierens, Herstellens und Erzeugens konzentriert". Sie möchten es um einen grundlegenden Aspekt erweitern, denn nicht nur das Handeln, sondern auch das Unterlassen von Handlungen könne performativ wirksam sein, Folgen zeitigen und Realität herstellen.
Diese These nun mutet banal an, denn mit jeder Handlung – auch und gerade auf der Bühne! – geht das Unterlassen einer ganzen Summe alternativer Handlungsmöglichkeiten einher. Gronau und Lagaay möchten den ihrer Meinung nach aktionistisch und positivistisch geprägten Begriff der "Performanz" um seine Rückseite erweitern, der Präsenz die Absenz hinzufügen, dem Tun das Nichttun, dem Vollzug den Entzug, dem Gelingen die Kapitulation.
Somit begreifen sie den Begriff der Performanz jedoch einfacher, als er angelegt ist – schon Austin hat auch Unglücksfälle berücksichtigt, in denen der Handlungsvollzug im Sprechen scheitert, etwa indem Fehler gemacht werden. Zudem lassen sie leider unter den Tisch fallen, dass diese Dialektik der Performativität bereits in zahlreichen Facetten aufgegriffen und reflektiert wurde, etwa in dem Begriff der "Abwesenheit" oder "Absenz", sowie in Forschungen über Leerstellen, Lücken und Spuren.
Alles andere als neu
Viele der Kriterien und Mittel, die die Herausgeberinnen für die "Performanzen des Nichttuns" anbringen, sind alles andere als neu: "Setzung von Leerstellen, (… das) Spiel mit Absenzen und der theatralen Aufführung bis hin zur endlosen Wiederholung und Überlagerung von Gesten, Zeichen und Formeln, sodass eine semantische Überdeterminierung erzeugt wird." Dies alles hat auch schon beispielsweise Hans-Thies Lehmann vor zehn Jahren unter dem Begriff des "Postdramatischen Theaters" subsumiert und analysiert.
Zudem wohnen den "Performanzen des Nichttuns" Probleme inne, die im Rahmen des Sammelbandes nicht differenziert behandelt werden. Woran erkennt man das Nichttun? Und wie stellt man seine Wirksamkeit fest, die die Autorinnen zum Kriterium für seine Rückbindung an die Performanz machen? Performanz hieße dann auch die Erkenn- und Wahrnehmbarkeit des Nichttuns als Nichttun, es bringt das Problem der Unerkennbarkeit von etwas mit sich, das auf der Grenze des Verschwindens operiert.
Auf der Grenze des Verschwindens
Diese Vagheitsmomente und Unschärfen schaffen letztlich mehr Unklarheiten, als sie beseitigen. So wirkt das breite Feld der Verweigerungstaktiken und Unterlassenspraktiken, das unter dem Leitbegriff versammelt wird, zuweilen beliebig – auch wenn einige sehr interessante Beiträge darunter sind. Das Spektrum reicht von sprachphilosophischen Untersuchungen zu Stille und Schweigen über mathematische Überlegungen zur Erfindung der Zahl Null, zu Hungerkünstlern und Anorexiepatientinnen bis zu künstlerischen Spätwerken.
Triftig sind dabei jene Ansätze, die eben die Entgegensetzungen und Enthüllungsgesten, deren sich die Herausgeberinnen bedienen, nicht verwenden. So entwirft beispielsweise Ludger Schwarte in "Die Kunst der Leerstelle. Sprachlosigkeit als Voraussetzung der Verständigung" Sprechen und Schweigen als voneinander untrennbare Phänomene, da Stille und Schweigen dem Sprechen vorausgehen und ihm nachfolgen, es aber auch in Form von Lücken und Pausen erst sinnhaft machen: "Dass wir etwas mit Worten tun, ist nur dann möglich, wenn ein Nicht-Tun uns unsere Sprecherposition zuweist."
Letztlich aber ist dies zu wenig, um einen neuen Begriff zu etablieren, der so zur Behauptung wird. Was leistet der Begriff, was andere Begriffe bisher nicht erfassten? Wie löst er das Paradox auf, das ihm innewohnt? Gronau und Lagaay bleiben die Antwort auf diese Fragen nicht nur im Vorwort, sondern auch in ihren eigenen Beiträgen schuldig, trotz oder wegen des aufklärerischen, schöpferischen Impetus', mit dem sie ihre Thesen vortragen.
Barbara Gronau, Alice Lagaay (Hg.)
Performanzen des Nichttuns.
Passagen Verlag. Wien 2008. 171 Seiten. 22,00 Euro.