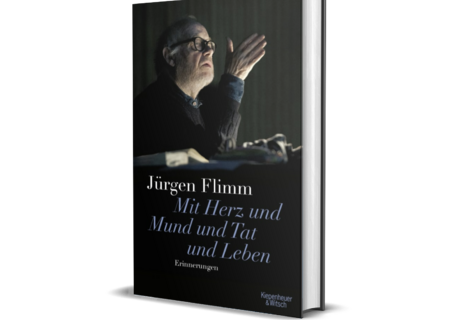Buchhinweise: Januar 2012
Was lernt man im Theater?
"Können wir vom Theater noch etwas lernen?" Diese Frage steht ganz oben auf dem Rückumschlag und klingt, als verheiße sie ein Ja. Auch das Inhaltsverzeichnis hört sich recht vielversprechend an: Da geht es um "Dumme Fragen" und "Autopannen", "Lügen" und "Hochzeit", "Intrigen" und "Rache" und – natürlich – "Lieben" und "Sex". Neugierig geworden, schlägt man den schmalen Band auf.
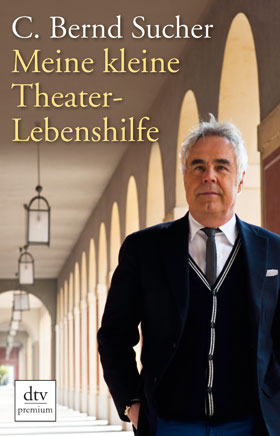 Doch schon nach wenigen Seiten dämmert's dem Leser, dass er wohl doch nicht allzu viel Neues erfahren wird: Dass etwa ohne "die sinnlich-erotische Liebe, das leidenschaftliche körperliche Begehren … Weltliteratur nicht denkbar" und dass "Verliebte unzurechnungsfähig sind" (alles Shakespeare), sich andererseits auch "ohne Worte verstehen" (Schiller) – geschenkt! Dass Eifersucht tödlich enden kann – unglaublich! Dass Rauchen die Gesundheit und die Beziehung (Yasmina Reza) gefährdet – sollte der Aufdruck auf jeder Zigarettenschachtel womöglich ein Resultat theatralischer Erfahrungen sein?
Doch schon nach wenigen Seiten dämmert's dem Leser, dass er wohl doch nicht allzu viel Neues erfahren wird: Dass etwa ohne "die sinnlich-erotische Liebe, das leidenschaftliche körperliche Begehren … Weltliteratur nicht denkbar" und dass "Verliebte unzurechnungsfähig sind" (alles Shakespeare), sich andererseits auch "ohne Worte verstehen" (Schiller) – geschenkt! Dass Eifersucht tödlich enden kann – unglaublich! Dass Rauchen die Gesundheit und die Beziehung (Yasmina Reza) gefährdet – sollte der Aufdruck auf jeder Zigarettenschachtel womöglich ein Resultat theatralischer Erfahrungen sein?
Intriganten, so hat der Autor herausgefunden, "entgeht man am besten, wenn man Neidern, Missgünstigen und Nebenbuhlern keine Angriffsfläche bietet". So so. Und um herauszufinden, dass zu viel Alkohol auch keine Lösung ist, braucht es ebenfalls nicht die Lektüre von Tschechow, Albee, Williams und O'Neill, die manche Szenen in ihren Dramen ausgiebig mit Wodka und Whiskey getränkt haben.
"Was lernen wir daraus?" lautet die stereotype Frage am Ende eines jeden Kapitels vor dem Fazit. Abgesehen davon, dass C. Bernd Sucher – von 1980 bis 1997 Theaterkritiker bei der "Süddeutschen Zeitung" und seit 1998 Leiter des Studiengangs Theater-, Film- und Fernsehkritik an der Bayerischen Theaterakademie August Everding – recht belesen ist, herzlich wenig. Dass die Bühne nicht mehr als "moralische Anstalt und Schule sittlicher Weisheit" (Schiller) funktioniert – ein Anspruch, der streng genommen von Anfang an eine idealistische Überhöhung und hoffnungsvolle Überschätzung der Wirkmächtigkeit des gespielten Wortes war (von einigen Ausnahmen abgesehen, die dann auch prompt das Missfallen der Zensoren erregten). Und dass das Theater, bei aller Liebe und Bewunderung, die es verdient, das wahre Leben doch nicht ersetzen kann. Schade eigentlich. (Rainer Nolden)
C. Bernd Sucher
Meine kleine Theaterlebenshilfe.
dtv München, 160 Seiten, 14,90 Euro
Soll man lieben? Oder hassen?
Erstaunlich, dass die intime Verwandtschaft von Theaterliebe und Bühnenhass in der Forschung bislang kaum beachtet wurde. Dabei ist, wie es in diesem Sammelband zutreffenderweise heißt, die "Feindschaft gegen das Theater so alt wie das Theater selbst". Bei Platon und seiner berühmten Missbilligung der darstellenden Künste hat sie schließlich schon angefangen.
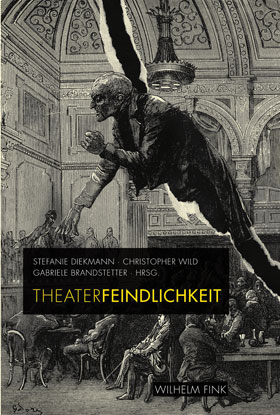 Es ist sogar so, dass immer dann, wenn das Theater "kulturell und gesellschaftlich am wirkmächtigsten war", es in den Augen seiner Gegner seine "subversivsten Kräfte" am spürbarsten entfaltete. Behaupten jedenfalls die Herausgeber dieses Buches – und wissen die einzelnen Beiträge größtenteils auch überzeugend zu belegen.
Es ist sogar so, dass immer dann, wenn das Theater "kulturell und gesellschaftlich am wirkmächtigsten war", es in den Augen seiner Gegner seine "subversivsten Kräfte" am spürbarsten entfaltete. Behaupten jedenfalls die Herausgeber dieses Buches – und wissen die einzelnen Beiträge größtenteils auch überzeugend zu belegen.
Man hat es bei diesem Phänomen offenbar mit einer gehörig verwickelten Dialektik zu tun: Theatrale Innovationen sind häufig gerade aus dem Geist der Theaterfeindschaft entsprungen, wesentliche Impulse hat die Bühne immer wieder von ihren Verächtern erhalten. Marina Abramović zum Beispiel gab zu Protokoll, das Theater "abgrundtief gehasst" zu haben – und hat daraus ihre viel gerühmte Performancekunst entwickelt. Überhaupt scheint, so legt Hans-Friedrich Bormann nahe, das Performancewesen wesentlich von dieser Theaterfeindschaft getragen zu sein. Oder Rousseaus einflussreicher "Brief an d'Alembert", der eine Abrechnung mit dem Theater sein will, unter der Hand aber genauso eine Liebeserklärung ist. "Er kann", schreibt Stefanie Diekmann, "das Theater nur in dem Maße ablehnen, indem er es liebt." Oder anders: Gerade weil er es so sehr liebt, muss er sich immer wieder darüber aufregen.
Die Liebe als Schwester des Hasses – das hat sich bis heute nicht geändert. (Dirk Pilz)
Stefanie Diekmann, Christopher Wild, Gabriele Brandstetter (Hg.):
Theaterfeindlichkeit.
Wilhelm Fink Verlag, München 2012, 209 S., 29,90 Euro
Ist das politisch? Oder Ideologie?
Aber sicher doch, jene Zweifel am traditionellen Verständnis von politischem Theater, die Jan Deck im Einleitungsessay zu diesem Band anspricht, sind durchaus angebracht. Allerdings kann von derlei Zweifeln nur ereilt werden, wer dieses traditionelle Verständnis oberflächlicherweise als "theatrales Aufarbeiten politischer Themen" begreift. Auf den Inhalt ließ sich Kunst (und das will Theater schließlich sein) aber noch nie bringen, nicht einmal bei Rolf Hochhuth. Auch nicht auf Stichworte wie "Engagement" oder "Aufklärung" – es gibt kein Drama und keine Inszenierung, die sich darauf reduzieren ließen, andernfalls hat man es nicht mit Dramen und Inszenierungen, sondern mit Verlautbarungen zu tun, die einem zugegebenermaßen auf den Bühnen nicht selten begegnen.
 Der Einleitungsessay – und mit ihm das Gros der Aufsätze in diesem Buch – unterstellt dem "alten" politischen Theater jedoch genau dies. Aus durchsichtigen Gründen: Hat man das "klassische Drama" und das "traditionelle politische Theater" erst in dieser Weise disqualifiziert, beginnen die "zeitgenössischen Theatermodelle" umso heller zu glänzen. Kein Scherz, so beneidenswert schlicht, nämlich dualistischer als selbst die härtesten Vertreter der mittelalterlichen Scholastik waren, geht's hier zu.
Der Einleitungsessay – und mit ihm das Gros der Aufsätze in diesem Buch – unterstellt dem "alten" politischen Theater jedoch genau dies. Aus durchsichtigen Gründen: Hat man das "klassische Drama" und das "traditionelle politische Theater" erst in dieser Weise disqualifiziert, beginnen die "zeitgenössischen Theatermodelle" umso heller zu glänzen. Kein Scherz, so beneidenswert schlicht, nämlich dualistischer als selbst die härtesten Vertreter der mittelalterlichen Scholastik waren, geht's hier zu.
Nur ein Beispiel für ein Argument, das allen Ernstes als solches gelten will: Weil sich das klassische Theater auf ein "Repräsentationsmodell" beziehe (der Darsteller xy verkörpert die Figur xy), sei es "in der monarchistischen Körpersymbolik" gefangen und bediene damit ein nichtdemokratisches System, während "postdramatisches Theater" aufgrund seiner Arbeits- und Darstellungsverfahren den "Ort der Macht" thematisiere und überdies "radikaldemokratisch" sei. Wer derlei ernsthaft glaubt, tut nichts weiter, als das traditionelle Verständnis von politischem Theater in neue Begriffsschläuche zu füllen, verkleinert also seinerseits die Kunst auf ihren Inhalt. Da hilft auch der Bezug auf die politische Philosophie von Jacques Rancière nicht, weil ihr zentraler Punkt (die Unterscheidung zwischen Politik und Politischem) damit gerade verfehlt wird.
Statt dessen wird mit derlei Pseudowissenschaft plumpe Deutungspolitik betrieben: Mit Modellen dieser Art soll auf Teufel komm raus ein ideologischer Graben zwischen "klassischem" und "postdramatischem" Theater etabliert werden. Warum auch immer, womöglich aus bloßen innertheaterwissenschaftlichen Geltungssüchten heraus. Dass aber damit über die Sache (das politische Theater) nichts gesagt, sondern das Problem (was verleiht einer ästhetische Erfahrung eine politische Dimension?) lediglich verschleiert wird, ist sehr schön aus diesem Band zu lernen. Dafür vielen Dank. (Dirk Pilz)
Jan Deck, Angelika Sieburg (Hg.):
Politisch Theater machen.
Neue Artikulationsformen des Politischen in den darstellenden Künsten.
transcript Verlag, Bielefeld 2011, 181 S., 24,80 Euro