Buchhinweise September 2012 - Ivan Nagel, Karel Čapek und das Reenactment
Der Spezialist als Bürger
Ein streitbarer Intellektueller war Ivan Nagel. Seine "Einsprüche" aus mehr als einem halben Jahrhundert sind nun in den "Schriften zur Politik" gesammelt, die – nach den Bänden zum Drama, zum Theater und zur Kunst – posthum erschienen sind. Der Neuheitswert der Beiträge ist begrenzt: Veröffentlicht wurde ein Großteil bereits in den "Streitschriften" und dem "Falschwörterbuch". Doch ergänzen sie das Bild des Kunstkritikers, Dramaturgen und Theateritendanten um eine bedeutsame Facette.
 Meinungsfreudig und mitunter polemisch kommentiert Nagel in seinen Aufsätzen, Reden und Briefen Kultur- wie Tagespolitik. "Nicht als Spezialist, sondern als Bürger" äußert er sich zur Wehrmachtsausstellung; streitet wider die Kriege im Irak und in Libyen; ergreift Partei im deutsch-deutschen Literaturstreit oder wendet sich gegen die Schließung des Berliner Schiller-Theaters. Impulsiv und parteiisch lesen sich Nagels Leserbriefe und Zeitungskommentare – er schreibt sie, weil ihm "der Kragen platzt". Der Kunstwissenschaftler und Philosoph gewinnt in den längeren Einlassungen die Oberhand. Hier deutet Nagel, in elegant ausgreifendem Bogen, Politik auf Grundlage der Kunst.
Meinungsfreudig und mitunter polemisch kommentiert Nagel in seinen Aufsätzen, Reden und Briefen Kultur- wie Tagespolitik. "Nicht als Spezialist, sondern als Bürger" äußert er sich zur Wehrmachtsausstellung; streitet wider die Kriege im Irak und in Libyen; ergreift Partei im deutsch-deutschen Literaturstreit oder wendet sich gegen die Schließung des Berliner Schiller-Theaters. Impulsiv und parteiisch lesen sich Nagels Leserbriefe und Zeitungskommentare – er schreibt sie, weil ihm "der Kragen platzt". Der Kunstwissenschaftler und Philosoph gewinnt in den längeren Einlassungen die Oberhand. Hier deutet Nagel, in elegant ausgreifendem Bogen, Politik auf Grundlage der Kunst.
Anlässlich der Aufführungen von Shakespeares "Julius Caesar" und Mozarts "La Clemenza di Tito" bei den Salzburger Festspielen 1992 etwa reflektiert Nagel über "Bürgerkrieg und Amnestie". Aus den Dramen wie den Erfahrungen der Geschichte schließt er, dass Vergessen für Ost- und Westdeutsche unabdingbar ist, um nach einem "Weltbürgerkrieg" wie dem Kalten Krieg wieder in Frieden zusammenzuleben. Die umstrittene Wehrmachtsausstellung denkt der ehemalige Intendant im Hamburger Schauspielhaus mit Bachs Matthäus-Passion zusammen: In beiden treten Gegenwart und Vergangenheit in einen Dialog, und auf einstige Verbrechen antworteten Schuldbekenntnis und Reue aus heutiger Sicht. Gegen den Einmarsch im Irak wiederum führt Nagel die Sprachkritik ins Feld: Sein "Wörterbuch der Kriegslügen" übersetzt die US-Formel von der "Entwaffnung" mit "Angriff", und die "preemptive strikes" sind ihm nicht Vorbeugung, sondern "Selbstermächtigung der einzigen Weltmacht".
Biografisch erklärt sich für Nagel die Notwendigkeit, seine Stimme zu erheben. Sein Lebenslauf lag stets quer zu den Zeitläuften, an ihm ließen sich aber auch gesellschaftliche Verwerfungen deutlich ablesen. Das zeigt die Dankesrede "Toleranz und Intoleranz: Erfahrungen" anlässlich des Moses-Mendelssohn-Preises im Jahr 2000, die dem Sammelband programmatisch vorangestellt ist. In welchem politischen System er auch lebte, Nagel gehörte einer Minderheit an. 1931 in Ungarn geboren, überlebt er als "ungläubiges, aber ungetauftes Judenkind” den Weltkrieg versteckt in einem Kinderheim, unter falschem Namen; im sozialistischen Ungarn darf Nagel als Bürgersohn nicht studieren; aus der BRD wird der staatenlose "Asylant" nur deswegen nicht abgeschoben, weil sich sein Lehrer Adorno für ihn einsetzt; als Homosexueller kann er in Deutschland für "Unzucht" mit mehreren Jahren Haft bestraft werden. Die Außenseiterposition hat Nagel für seine Arbeit produktiv gewendet: Wenn er, als ehemaliger FAZ-Kulturkorrespondent in New York, über die zunehmende Entsolidarisierung der US-amerikanischen Juden mit Minderheiten wie den Homosexuellen schreibt, überlagern sich Teile seiner Identität auf spannungsvolle Weise.
Aus den Kindheitserfahrungen resultiert auch Nagels strikte, uneingeschränkte Ablehnung jeglichen Krieges. Die Furcht vergröbert mitunter seine Wahrnehmung. Im warnenden Rundfunkbeitrag "Zwang zur Kritik" (1974) kündet ihm das zum Jargon verkommene Denken der radikal Linken von einer neuen Meinungsdiktatur, einer Herrschaft des Mittelmaßes, kurz: einer Konstellation wie zur Nazizeit. Nagels Besorgnis ist an Wortschöpfungen wie "Schlagwort-Abzeichen" oder "Gruppenschutz" für argumentative Mitläufer ablesbar, und im Affekt lässt er sich gar zur Stereotypisierung hinreißen. Er entwirft das Bild des "stud.phil. aus Kleinbürgermilieu, der durch germanischen Kommandotenor und Nussknackerkiefer zum Volksschulpauker prädestiniert ist". Dass seine "Furcht vor dem totalitären Potential der Studentenbewegung [...] heute übertrieben scheinen" mag, thematisiert Ivan Nagel jedoch selbst in der kurzen Einleitung, mit der er jeden Beitrag noch versehen hat.
Als einen Aufrechten, Unbeugsamen zeigen die gesammelten "Schriften zur Politik" Ivan Nagel. Sie erfüllen seine im Vorwort geäußerte Hoffnung, eine konsequente persönliche Haltung zu belegen. Der Theatermann tritt dem Leser entgegen als Citoyen, und man möchte ihm ein Wort Peter Handkes zuschreiben, das er im Beitrag "'Deutscher Literaturstreit' und Intellektuellenjagd" zitiert: "Eine engagierte Literatur gibt es nicht. Es gibt engagierte Menschen." (Elena Philipp)
Ivan Nagel:
Schriften zur Politik
Suhrkamp Verlag, Berlin 2012, 295 S., 26. 95 Euro
Es versteht ja keiner
"W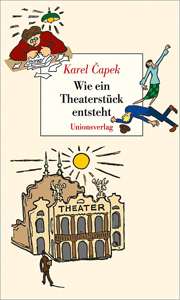 ir wollen hier keineswegs den fälschlichen Eindruck erwecken, als verstünden wir das Theater", warnt Karel Čapek gleich zu Beginn: "Fakt ist, dass niemand das Theater versteht, weder die auf den Brettern in Ehren Ergrauten noch der älteste Direktor, ja nicht einmal die Kritiker." Stimmt. Dennoch hat sich Čapek, der tschechische Journalist, Schriftsteller, Dramatiker und Dramaturg 1925 die Mühe gemacht, es in "Wie ein Theaterstück entsteht" zu erklären. Mit sanfter Ironie, melancholischem Blick und satirischen Zuspitzungen plaudert sich Čapek unterhaltsam und am Beispiel eines jungen Dramatikers und seines Stücks durch Probenkatastrophen bis zur Premiere. Nebenbei erklärt er knapp alle damaligen Gewerke und Etagen vom Intendanten bis zum Möbelträger.
ir wollen hier keineswegs den fälschlichen Eindruck erwecken, als verstünden wir das Theater", warnt Karel Čapek gleich zu Beginn: "Fakt ist, dass niemand das Theater versteht, weder die auf den Brettern in Ehren Ergrauten noch der älteste Direktor, ja nicht einmal die Kritiker." Stimmt. Dennoch hat sich Čapek, der tschechische Journalist, Schriftsteller, Dramatiker und Dramaturg 1925 die Mühe gemacht, es in "Wie ein Theaterstück entsteht" zu erklären. Mit sanfter Ironie, melancholischem Blick und satirischen Zuspitzungen plaudert sich Čapek unterhaltsam und am Beispiel eines jungen Dramatikers und seines Stücks durch Probenkatastrophen bis zur Premiere. Nebenbei erklärt er knapp alle damaligen Gewerke und Etagen vom Intendanten bis zum Möbelträger.
Was auch heute seine Wirkung nicht verfehlt, da niemand mehr von Rollenfächern spricht und der Theaterbote längst eingespart ist. Weil Čapek die Seele des Ganzen trifft, dieses merkwürdige Amalgam aus Chaos und Ordnung, Hysterie und Aktenverwaltung, Kunstgewerbe und Genie. Die karikaturhaften Zeichnungen seines Bruders Josef machen das Büchlein zur Preziose, zum Geschenk auch für die, die das Theater (heute) eher aus der Distanz lieben.
Ein kleines Wunder, dass der sonst nicht sonderlich theateraffine Unionsverlag das Werk wiederentdeckt und so altmodisch-schön ediert hat. Ein größeres bleibt das Theater selbst: "Wenn sich abends um acht Uhr der Vorhang hebt, dann sei man sich bewusst, dass dies ein glücklicher Zufall oder geradezu ein Mirakel ist." (Georg Kasch)
Karel Čapek:
Wie ein Theaterstück entsteht.
Aus dem Tschechischen von Otto Pick und Vincy Schwarz.
Mit 47 Zeichnungen von Josef Čapek.
Unionsverlag 2012, 180 Seiten, 12,90 Euro.
Wieder holen
Es wurden früh schon Geschehnisse der Geschichte nachgespielt, auf der Hundertjahrfeier des amerikanischen Bürgerkrieges zum Beispiel. Bis heute sind solche Wiederholungen beliebt als Hobby und Touristenattraktion, Mittelalterspektakel etwa: gern besucht. Darum geht es diesem Aufsatzband der beiden Hildesheimer Theaterwissenschaftler allerdings weniger. Er beschäftigt sich vornehmlich mit jenen künstlerischen Strategien, die unter dem Begriff Reenactment gehandelt werden. Er werde, heißt es im Vorwort, auf derart vielfältige Weise aufgegriffen und weitergereicht, dass seine Kontur dadurch "nicht eben schärfer" geworden sei. So ist es.
 Eine abschließende Definition wird allerdings auch hier nicht gegeben, denn die "besondere Leistung des Begriffs" bestehe darin, "hegemoniale kunst- und kulturwissenschaftliche Diskurse zu enthierarchisieren und dabei sowohl kategoriale als auch disziplinäre Grenzen munter zu ignorieren". Gemessen daran ist dieser Band vorbildlich. Die einzelnen Beiträge schauen auf so verschiedene künstlerische Praxen, wie sie von Rimini Protokoll oder im Dokumentarfilm der 30er und 40er Jahre betrieben werden, untersuchen Reenactments als Freilufttheater oder die "Formen der Wiederholung in politischen Bewegungen". Die mehr oder weniger offen gestellte Grundfrage scheint dabei immer diejenige zu sein, warum sich Reenactments sowohl als Hobby wie als theatrale Strategie derzeit so großer Beliebtheit erfreuen.
Eine abschließende Definition wird allerdings auch hier nicht gegeben, denn die "besondere Leistung des Begriffs" bestehe darin, "hegemoniale kunst- und kulturwissenschaftliche Diskurse zu enthierarchisieren und dabei sowohl kategoriale als auch disziplinäre Grenzen munter zu ignorieren". Gemessen daran ist dieser Band vorbildlich. Die einzelnen Beiträge schauen auf so verschiedene künstlerische Praxen, wie sie von Rimini Protokoll oder im Dokumentarfilm der 30er und 40er Jahre betrieben werden, untersuchen Reenactments als Freilufttheater oder die "Formen der Wiederholung in politischen Bewegungen". Die mehr oder weniger offen gestellte Grundfrage scheint dabei immer diejenige zu sein, warum sich Reenactments sowohl als Hobby wie als theatrale Strategie derzeit so großer Beliebtheit erfreuen.
Für die Berliner Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte ist er in der "transformativen Kraft" zu suchen, also in einer Aneignung von Geschichte, bei der die Zuschauer mittun, um die Geschichte(n) selbst "für die Zukunft fruchtbar zu machen". Gerade auch dadurch, indem man sie um- und neuschreibt. Für den Regisseur und ausgewiesenen Reenactment-Fachmann Milo Rau liegt die "seltsame Kraft der Wiederholung" in einem kalten, "extremen Realismus": wie bei einer Ausgrabung erscheine der Mensch "gleichsam in seinem geschichtsphilosophischen Holozän".
Es bleibt die Frage, die sich – im Anschluss an Ulf Ottos im Abschlussaufsatz des Bandes – stellt: Wird Geschichte im Reeanctment wiederholt oder wird sie wieder geholt? (Dirk Pilz)
Jens Roselt, Ulf Otto (Hg.):
Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments.
Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven.
transcript, Bielefeld 2012, 260 S., 27,80 Euro
Weitere Bücher? Bitteschön.
mehr bücher
meldungen >
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral



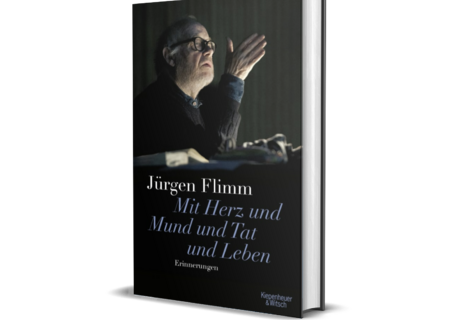









neueste kommentare >