Hildesheimer Thesen X - Theater als Kulturindustrie: Globale Perspektiven in einer reflexiven Moderne
Dritter Weg statt McTheatre
von Christopher Balme
Hildesheim, 9. Januar 2013
These 1
Der Titel des Vortrags stellt eine contradictio in adjecto dar. Europäisches Theater, zumal deutsches Theater, steht im diametralen Gegensatz zum Begriff der Kulturindustrie, wie er von Horkheimer und Adorno in der "Dialektik der Aufklärung" formuliert wurde. Das deutsche Theatersystem wurde ja entwickelt, damit sich Theater den gnadenlosen Mechanismen des Marktes, den Gesetzen von Angebot und Nachfrage entziehen könne. Auch kann das Theater als Kunst des Hier und Jetzt, der Feedback-Schleife der Kopräsenz, kaum mit der gegenwärtigen Diskussion um Globalisierung in Verbindung gebracht werden.
These 2
Historisch betrachtet war das deutsche Theater jedoch viel stärker verwoben mit der Kulturindustrie als allgemein angenommen. Die großen Sternstunden deutscher Theaterkunst – das Deutsche Theater Max Reinhardts, Brecht/Weills "Die Dreigroschenoper", Otto Falckenbergs Münchner Kammerspiele, das Kabarett usw. – waren allesamt privatwirtschaftliche Unternehmungen. Auch das gute, gar nicht so alte Stadttheatersystem wurde von den meisten Städten privatwirtschaftlich finanziert und gewinnorientiert organisiert. Erst unter dem Einfluss sozialdemokratischer Politik nach 1918 setzte seine 'Sozialisierung' ein, mit dem Ziel, es in die jeweilige Staats- oder Stadtverwaltung zu integrieren, ein Prozess, der erst unter den Nationalsozialisten erfolgreich zur Vollendung gebracht wurde.
These 3
Der Begriff der Kulturindustrie muss neu und differenzierter betrachtet werden. Es lohnt ein erneuter Blick auf die Veröffentlichung der UNESCO aus dem Jahr 1982 "Cultural Industries: a challenge for the future of culture". Hier beginnt eine Umfunktionierung des Konzepts von einer ausschließlich negativen hin zur einen positiven Begriffsbestimmung: Kulturindustrien können die Ausübung künstlerischer Berufe und Kreativität im Allgemeinen radikal transformieren, den Austausch zwischen Künstlern und der Bevölkerung fördern und, vor allem, Bildungsinitiativen, sei es innerhalb oder außerhalb der Schule, frischen Impetus verleihen sowie die effektive Partizipation des Volkes in der Gestaltung ihrer Kultur stärken.
These 4
Die theaterwissenschaftliche Diskussion heute um das Thema Globalisierung verharrt weiterhin in einem Wertesystem, das die Thesen der Frankfurter Schule fortschreibt. Dan Rebellatos Begriff des "McTheatre", um die Musicalindustrie als Verlängerung eines, den Dynamiken der Verwertungsketten und Produktentwicklung verschriebenen Großkapitals zu beschreiben, kann als exemplarisch gesehen werden.
These 5
Gibt es einen dritten Weg zwischen McTheatre einerseits und Theater als verlängertem Arm des Sozialstaats andererseits? In Anlehnung an Anthony Giddens' Begriff des "Dritten Wegs" als Reformvorschlag für eine modernisierte Sozialdemokratie kann man die Erfolgsgeschichte des National Theatre of Great Britain betrachten. Sinkenden Zuschüssen der öffentlichen Hand stehen erhöhte Gesamteinnahmen gegenüber, die vor allem durch den 'Export' erfolgreicher Inszenierungen in den kommerziellen Theaterbereich, nicht nur in London, sondern in verschiedene Länder erzielt werden. Giddens' Begriff der Reflexivität folgend soll argumentiert werden, dass das NT diese Reflexivitätsprozesse auf institutioneller Ebene vollzogen hat.
These 6
Für deutsche Verhältnisse bedeutet dies, Entwicklungs- und nicht nur Kürzungspotentiale aufzuzeigen. Es geht auch darum, dem gegenwärtigen öffentlichen Diskurs entgegenzuwirken, der Kulturinstitutionen als Subventionsempfänger diskreditiert. Wenn in der Süddeutschen Zeitung (am 5.1.2013) ein ganzseitiger Artikel über die Höhe der städtischen Zuschüsse für Kultureinrichtungen unter dem Stichwort "Am Tropf" Position bezieht, dann wird die Wirkung nicht lange ausbleiben. Vom Tropf zur Palliativmedizin ist nur ein kleiner Schritt. Wenn 85% der Einnahmen der meisten Theater öffentliche Zuschüsse ausmachen, dann ist es auch einfacher, den Hahn abzudrehen, den Off-Switch zu betätigen. Das Beispiel des NT zeigt aber vor allem, dass öffentliche Gelder im Sinne von Investitionen und nicht nur als Verlustausgleich verwendet werden können. Kulturindustrie bedeutet dann eine komplexe Verflechtung von öffentlichen Zuschüssen, kommerziellen Einnahmen, Spenden, Sponsoring, Fundraising, aber auch von accountability. Jedes börsennotierte Unternehmen in Deutschland gibt mehr finanzielle Informationen preis als die meisten öffentlichen Theater hierzulande.
 Christopher Balme, geb. 1957, seit 2006 Professor für Theaterwissenschaft an der Universität München; Herausgeber der Zeitschrift Forum Modernes Theater und Präsident der International Federation for Theatre Research; Projektleiter der Weiterbildung Theater- und Musikmanagement. Wichtige Publikationen: Texte zur Theorie des Theaters, hrsg. mit Klaus Lazarowicz; Decolonizing the Stage: Theatrical Syncretism and Post-Colonial Drama (1999); Einführung in die Theaterwissenschaft (1999). Das Theater der Anderen (Hg.) (2001); Pacific Performances: Theatricality and Cross-Cultural Encounter in the South Seas (2007); Cambridge Introduction to Theatre Studies (2008).
Christopher Balme, geb. 1957, seit 2006 Professor für Theaterwissenschaft an der Universität München; Herausgeber der Zeitschrift Forum Modernes Theater und Präsident der International Federation for Theatre Research; Projektleiter der Weiterbildung Theater- und Musikmanagement. Wichtige Publikationen: Texte zur Theorie des Theaters, hrsg. mit Klaus Lazarowicz; Decolonizing the Stage: Theatrical Syncretism and Post-Colonial Drama (1999); Einführung in die Theaterwissenschaft (1999). Das Theater der Anderen (Hg.) (2001); Pacific Performances: Theatricality and Cross-Cultural Encounter in the South Seas (2007); Cambridge Introduction to Theatre Studies (2008).
Mehr zur Vorlesungsreihe: www.uni-hildesheim.de
Alle Hildesheimer Thesen sind im Lexikon zu finden.
Siehe auch: die Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.
mehr debatten
meldungen >
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater Weimar
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
neueste kommentare >
-
Bachmann an der Burg Wo ist das Junge Theater?
-
Intendanz Weimar Kompliziert
-
Medienschau Alexander Scheer Keine Nebelkerzen
-
Intendanz Weimar Eigentor
-
Intendanz Weimar Faktenlage
-
Medienschau Kulturkürzungen Fragen
-
Medienschau Alexander Scheer Exo-Planet
-
Harzer nach Berlin Macbeth?
-
Intendanz Weimar Ruhe
-
Zentralfriedhof, Wien Große Enttäuschung



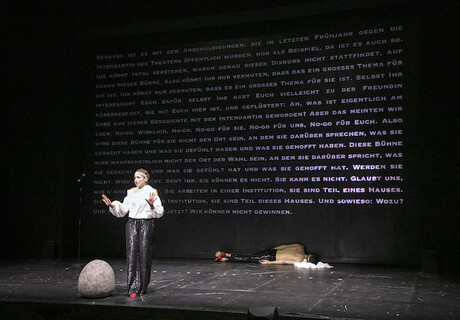





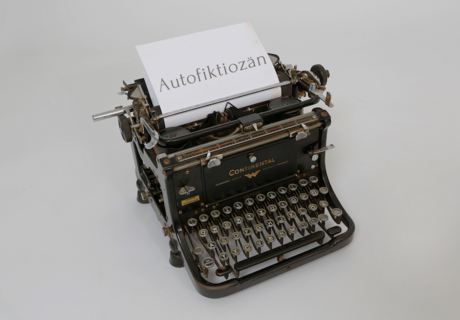












Balmes Beispiel vom Warhorse als Cashcow am National Theatre erscheint mir jedoch eher als One Hit Pony, getragen von der künstlerischen Exzellenz des Hauses und der Ausschlachtung durch Hollywood. Eine verantwortungsvolle Kulturpolitik, so meine Hoffnung, weiß die Kulturförderung allemal besser zu verwalten als es die Gesetze des Marktes vermögen. Und letztendlich ist die Alternative zur sozialdemokratischen Theaterverwaltung die Abhängigkeit von Mäzeen.
Vielmehr möchte er denke ich ein Umdenken der staatlich geförderten Institutionen erreichen, das bei sehr hoher Nachfrage über die Transferierung in eine privatwirtschaftliche Ensuiteproduktion nachgedacht wird. Das muss aber nicht gleich eine Ausschlachtung durch Hollywood bedeuten, sondern könnte vielleicht tatsächlich eine Chance zur Querfinanzierung anderer Produktionen sein.
Die Ensuite-Musicals in Hamburg werden nicht durch die Stadt Hamburg gefördert. Die Kulturtaxe wird laut Pressestelle der Stadt wie folgt verwandt:
"Konkret werden im Bereich Kultur die Museen durch den auf 2,5 Millionen Euro aufgestockten Ausstellungsfonds finanziell gestärkt. Zum Ausbau der Musikstadt Hamburg werden aus der Kultur- und Tourismustaxe 1,4 Millionen Euro bereitgestellt sowie zur Stärkung der Hamburger Festivallandschaft 1,2 Millionen Euro eingestellt. Neu eingerichtet zur Förderung von Kulturprojekten wird der mit 500.000 Euro ausgestattete Elbkulturfonds, über dessen Vergabe ein wechselndes Expertengremium entscheiden wird. Darüber hinaus werden die Marketingaktivitäten der Hamburg Tourismus GmbH – mit Schwerpunkt Auslandsmarketing - ausgebaut, die Service-Infrastruktur für die Gäste Hamburgs erweitert und das Hamburg Convention Bureau gestärkt. Im Sport liegt im Rahmen der Dekadenstrategie des Senates der Schwerpunkt auf der Unterstützung von Großveranstaltungen wie u.a. dem Triathlon, den Cyclassics, dem Marathon oder der für 2014 geplanten Ruder Junioren Weltmeisterschaft. Weiterer Gegenstand der Mittelverwendung sind Medienevents, die geeignet sind, Hamburgs führende Rolle als Medienstandort zu unterstreichen und zu stärken, wie z.B. der Deutsche Radiopreis, das Art Directors Club Festival oder die Lead Awards. Über die Ergebnisse und Erfahrungen bei den geförderten Projekten wird der Senat der Hamburgischen Bürgerschaft spätestens im 1. Quartal 2014 berichten."
Quelle: http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/3730798/2012-12-18-bwvi-kulturtaxe.html
Die großen Musicals sind rein privatwirtschaftliche Häuser ohne staatliche Zuwendungen. Musical wird insofern in Deutschland nur staatlich unterstützt, wenn es an einem öffentlichen Theater im Repertoire gespielt wird.
Und Musical bedeutet auch nicht zwangsläufig Verflachung. Es ist bloß so, dass die anspruchsvolleren Stücke in Deutschland kaum gespielt werden. Die Ensuite-Produktionen bestehen aus kommerziellen Topsellern, die heutzutage häufig im Gewand einer einfallslosen Compilation-Show daherkommen (Udo Jürgens-Songs, Quen-Songs, etc.) Und die Stadttheater wollen meistens mit den etablierten Klassikern ihre Häuser vollkriegen, um die Auslastung zu steigern, ohne echtes Interesse am Genre.
Außerdem betonte er in seinem Vortrag, dass Warhorse auch eine "Risiko-Produktion" war, da es sich mit Themen beschäftigt, die schon an andere Medien wie z.B.: Film "abgegeben" worden seien nämlich Tiere und Krieg. Um auf die Kritik von Hollywoodproduktionen zu reagieren.
Ich frage mich vielmehr, wie man den Erkenntnisgewinn dieses Modells auf beispielsweise Deutschland übertragen will und zukünftig einsetzten bzw. nutzen kann (denn das halte ich für eine interessante Idee), wenn doch der Erfolg beim Publikum vom Zufall abhängig ist. Dieser unbeeinflussbare Punkt ist für mich die größte Schwachstelle in diesem Modell und ich bezweifle, dass lediglich eine Selbstreflektion, wie Herr Balme sie ansprach, nicht ausreichen wird
1) im Bereich des subventionierten Schauspieltheaters: Die Musicalproduktion "Marie Antoinette" unter der Intendanz von Hans-Joachim Frey am Theater am Goetheplatz in Bremen ist an einer finanziellen Verspekulierung bzw. am Desinteresse des Publikums gescheitert.
2) im Bereich des Privattheaters: Der Admiralspalast in Berlin arbeitet wohl über Ensuiteproduktionen, er produziert für mich persönlich jedoch überwiegend leider nur "Mist" - oder auch: Entertainment for the Masses/Braindead. Nicht anders als in den Hamburger Musicaltheatern.
Das ist leider falsch.
Wenn Herr Prof. Balme Quellenforschung über die Finanzierung der Theater jenseits von Berlin in den Jahren 1918-1933 treiben würde, statt zu theoretisieren (zu spekulieren), würde er rasch feststellen, dass die durch soziale Aufgaben (Inflation, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot etc.) finanziell ohnehin bereits mehr als überlasteten Kommunen alles taten, um nicht auch noch die Theaterfinanzierung aufgebürdet zu bekommen. Die Folge wäre gewesen, dass die nach 1918 mehrheitlich schwach besuchten Theater jenseits von Berlin zusammengebrochen wären. Und dies wiederum hätte die Folge gehabt, dass 1. die kulturelle Versorgung und Attraktivität der Städte erdbebenartig eingebrochen wäre, 2. die Massenarbeitslosigkeit durch die Massen arbeitsloser Theaterleute weiter zugenommen hätte, 3. das Selbstverständnis des durch den Verlust des Krieges und den Versailler Vertrag ohnehin gedemütigten deutschen Volkes nun auch noch die Stütze verloren hätte, ein "Kulturvolk" der Dichter und Denker zu sein. Lübeck z.B., das 1922/23 mehr als pleite war und von Hungerdemonstrationen der arbeitslosen Werftarbeiter erschüttert wurde, sparte unter Berufung auf genau diese Gründe die Stadtbeleuchtung im Sommer ein, um mit den frei werdenden Mitteln sein Theater zu halten. Freiburg i.Br. versuchte es mit einer Mischung aus Kürzungen an anderen Stellen im Haushalt und einer theaterinternen Reduktion der Gehälter, Beuthen in Oberschlesien wandte sich an die Preußische Regierung um finanzielle Hilfe. Das alles geschah nicht "mit dem Ziel, die Theater in die jeweilige Staats- oder Stadtverwaltung zu integrieren" - im Gegenteil: die Stadträte wehrten sich dagegen. Es war auch keine Spezialität "der" Sozialdemokratie, sondern ein parteiübergreifendes Thema. Die Stadträte legten Wert darauf zu betonen, dass die "Kommunalisierung" der Theater zeitlich befristet sei. Die Subventionierung sei in besseren Zeiten wieder rückgängig zu machen. Durch die Subventionierung des Theaters sollte verhindert werden, dass das Heer der Arbeitslosen weiter anschwoll und aus dem Ruder lief und verarmte Volksschichten sich den Theaterbesuch nicht mehr leisten konnten. Statt unproduktiver Arbeitslosenunterstützung bei gleichzeitiger Proletarisierung des absinkenden Bürgertums wollte man lieber Subventionen für's Theater zahlen.
Mir ist noch nicht ganz klar, was Herr Balme genau mit den Investitionen meint.
In was soll investiert werden? In was sollte ein Theater in Deutschland investieren?
In teure Produktionen, die am Ende dann vielleicht doch keine Erfolgsgeschichte schreiben?
Wohl kaum.
Aber wie genau soll die zukünftige Finanzierung aussehen?
Und wie kann das Verlustausgleich-Denken verschwinden?
Ich finde, dass auf diesen spannenden Punkt noch viel genauer hätte eingegangen werden können.
Ich möchte natürlich niemanden persönlich angreifen, doch die Anmerkung von "Peter" finde ich doch sehr zweifelhaft, egal welchen Inhalt sie gehabt sonst hätte. Meiner Meinung nach geht es hier lediglich um Kommentare zum Vortrag und ich denke, mit dieser Meinung stehe ich nicht allein da.
Ich bin voll und ganz der Auffassung von Janensa - meiner Meinung nach beinhaltet die Argumentation nicht, dass sich ein öffentlich gefördertes Theaterhaus an private Institutionen und deren Programm angleichen muss. Ich glaube auch nicht, dass Produktionen in der Intention inszeniert werden, ob sie ein Publikumsmagnet werden oder nicht, doch - wie im vorigen Kommentar schon angeführt - muss wohl jeder zugeben, dass ein Theater oftmals von den Inszenierungen lebt, die beim Publikum gut ankommen! Warum sonst werden manche Produktionen wieder und wieder in folgende Spielzeiten übernommen? Die Vielfalt hat dadurch eher die Möglichkeit fortzubestehen, denn ein Theater, dass nur Produktionen zeigt, die sich keiner anschaut, sind (leider!) oftmals zum Scheitern verurteilt...
Natürlich ist das beschriebene System des National Theatre nicht eins zu eins übertragbar, jedoch kann es als Vorbild dienen, mit sinkenden Subventionen umzugehen. Erfolgreiche Produktionen auszulagern und en suite zu spielen bedeutet zwar eine Reform des Ensemble- und Repertoiregedankens, so wie er für die deutsche Stadt- und Staatstheaterlandschaft konstitutiv ist, birgt aber auch die Chance, Arbeitszeiten und – verhältnisse zu verbessern. Wird eine Inszenierung eine Woche lang en suite gespielt und pausiert dann, kann dann, je nachdem, wie viele Inszenierungen die Institution bietet, Freiraum geschaffen werden, indem die Beteiligten ihren Körper regenerieren können. Mittlerweile mehren sich ja in diversen Theatern die Beschwerden über Burn-out und Überlastung. Gastredner Thomas Schmidt (Hildesheimer Thesen vom 28.11.2012)z.B., beklagte während seines Vortrages, dass alle Mitarbeiter am Weimarer Nationaltheater mittlerweile an der Belastungsobergrenze arbeiten. Sicherlich nicht der einzige Fall und das ensuite- System mit Abwechslung könnten dem entgegenwirken.
Die Mehreinnahmen aus „kommerzialisierten“ erfolgreichen Produktionen könnten z.B. in die Förderung von jungen Künstlern investiert werden. Labore für experimentelle, andere Sichtweisen könnten eingerichtet werden, ohne gleich darauf zu schielen, ob es das „normale“ Publikum des Hauses eventuell verschrecken könnte.
Dass das National Theatre ein Paradebeispiel für die Finanzierung von Theatern sein soll, habe ich schon öfter gehört, aber noch nie so gut erklärt bekommen.
Ich glaube nämlich auch, dass die Subventionierung der deutschen Theater auf Dauer zurückgeschraubt werden sollte. Ich sehe in einer Kürzung nämlich die Chance zum Risiko.
Seltsamerweise ist es gerade so, dass die staatlich geförderten Theater sich nichts mehr trauen. Es werden kaum experimentelle Stücke inszeniert. Immer wieder werden die Klassiker aufgeführt, bei denen man sich seines Publikums sicher sein kann.
Ich könnte mir daher vorstellen, dass durch eine teils private Finanzierung, also ein Art Mischfinanzierung wie beim NT, neue Ideen und Visionen auf unsere etwas eingetrocknete Theaterlanschaft Einfluss nehmen könnten.
Wie Herr Balme es auch sagte, wäre das NT damals nicht durch die Kürzung der staatliche Zuschüsse gezwungen worden nach anderen Finanzierungswegen zu suchen, wäre wahrscheinlich bis heute alles beim Alten geblieben.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Theater auch andere Wege finden werden sich teilweise selbst zu finanzieren.
Beispiele dafür sind wie bestimmt bekannt, Stücke en suite zu spielen oder mehr auf Nachfrage und weniger nach Spielzeit die Stücke auszuwählen. Viel zu oft habe ich es nämlich schon erlebt, dass Theatersäle bei bestimmten Inszenierungen zum Ende einer Spielzeit nur noch zu einem Drittel gefüllt waren.
Eine Teilsubventionierung vom Staat sollte allerdings genau aus den Beispiel von "War Horse" erhalten bleiben, damit man den Mut zum Risiko beibehalten kann, den die bisherigen Theater durch ihre hohe Subventionierung eigentlich schon haben sollte.
Wir leben in einem Land, das sich als Kulturnation versteht, in dem Kunst und Kultur hochgehalten und gefördert werden. Und wer in Deutschland von Kultur spricht, kommt um die Diskussion über „gut oder schlecht“, „E oder U“, „Tiefgang oder Entertainment“ nicht herum. Theater ist wichtig. Es soll möglichst viele Menschen erreichen. Gleichzeitig scheint man aber stets besorgt, dass sich ja keiner zu gut amüsiert. Denn um Unterhaltung geht es hier schließlich nicht. Ich übertreibe natürlich. Aber es scheint mir manchmal, als würde grundsätzlich alles verteufelt, das nicht mindestens schwer verdaulich ist. Interessant fand ich da den Hinweis von Herrn Balme bezüglich der „Dreigroschenoper“ als Theaterstück der Privatwirtschaft – heute ganz klar Teil der geliebten Hochkultur.
Ich glaube, dass das System der Kulturförderung, wie es in Deutschland derzeit noch einigermaßen funktioniert, gut und wichtig ist, um die Freiheit der Kunst zu gewährleisten. Dass dabei versehentlich sogar mal ein Publikumsliebling herauskommt, lässt sich manchmal nicht vermeiden. So wie ich Herrn Balme verstanden habe, setzt die Idee des NT genau da an, nämlich, dass das Theater bei steigender Nachfrage einer bereits bestehenden Inszenierung in die kommerzielle Theaterlandschaft expandiert. Daran scheint mir nichts Falsches. Und wenn auf diese Weise sogar Einnahmen in des Theater zurückfließen können – es war die Rede von einer gemischten Finanzierung – umso besser.
Was dabei die Qualität es Theaters angeht, so glaube ich, täte uns allen ein bisschen weniger Verkrampftheit gut. Denn wer entscheidet letztlich, was wertvoll ist und was nicht? Zudem ist Kunstverständnis auch etwas, das sich mit der Zeit und den Menschen wandelt, man denke da nur an Streetart. Daher mein Plädoyer: Offen bleiben!
Eine derartige Risikoförderung, so behaupte ich, werde aber gerne eines besseren belehrt, ist in der Kulturindustrie in den Bereichen Kabarett, Musical etc. schwer aufzutreiben. In der (Ingenieurs-, Pharma- etc.) Industrie werden immense Summen in die Erforschung neuer Produkte gesteckt. Bis zu 4 Jahre Risikoförderung, die in Kauf nimmt, dass am Ende nichts brauchbares dabei herauskommt. Gibt es das nicht in der Kulturindustrie, haben innovatives, reflexives und kontroverses keinen Raum in den Varietétheatern dieser Nation zu entstehen. Der Kulturpolitische Einfluss ist hier natürlich sehr begrenzt. Vielleicht muss es also damit beginnen spannenden Projekten aus dem geschützten Kunstbetrieb den Weg in die Massenkultur zu erleichtern.
Kulturelle Grundlagenforschung muss auch als solche gesehen werden und darf nicht nach 20 Jahren in den schwer zugänglichen Teilen der Archive verschwinden. Vielleicht kann das aus öffentlichen Geldern finanzierte Theater in Hollywood etwas abgucken und einen Nutzen aus den bestehenden kapitalistischen Strukturen ziehen. Zunächst vertraue ich auf die Reflektierte, kritische Denkkultur der Theaterbetriebe, dass der Fokus dadurch in Zukunft nicht auf der Entwicklung angepasster Spektakelprodukte liegt.
# Die eine Struktur der traditionellen Institution, in denen eine kleine Hand voll Menschen Geld verdient, arbeitet unter gesonderten Bedingungen des Markts. Was könnte der Begriff "Tradition" bezeichnen? Vielleicht eine Zirkulation von Geldmitteln innerhalb einer exklusiven Gruppe, die sich nach außen hin abschottet?
# Die andere Struktur der individuellen Selbstorganisation arbeitet unter (über)flexiblen, normalen Bedingungen der Markets. In der Konstruktion ihrer Funktion für die Gesellschaft, will diese Struktur sich auf die Situation der Kommunikation zwischen Künstler und Bevölkerung konzentrieren, sie im "Hier und Jetzt" abholen, anstelle moralischer Regiezeigefinger. Meiner Beobachtung nach ergeben sich aus zweiter Struktur nun vorallem innovative, ästhetische Formen, die sich nicht immer dem Hier und Jetzt des Publikums orientieren. Der Inhalt ist zwischen beiden Strukturen beinahe austauschbar.
## Die institutionelle Struktur des deutschen Raums, also aus öffentlicher Hand geförderte Theaterhäuser als Laboratorien für international erfolgreiche Theaterproduktionen, mit freien Theatergruppen zu verknüpfen, simuliert einen dritten Weg?
Die vom Balme vorgetragenen Beispiel "Warhorse" etc. erinnern dabei aber eher an mythisch aufgeladene Erfolgsgeschichten von einer handvoll, spezialisierter Reflexiven.
### Um als dritter Weg für mehrere gangbar zu werden benötigt es nicht mehr beider Strukturen.
##### Denn vor der Wahl zwischen zwei Strukturen stehend, entscheidet sich das Groß der Arbeitssuchenden dann wohl doch für erste Struktur, damit einhergehend die Möglichkeit sogar ein Kind, Auto, Altervorsorge und Krankenversicherung zu unterhalten.
* Auf der Suche nach einem "dritten Weg" für die Theaterindustrie klingt das Modell vieler "abgespeckter" Laboratorien mit wechselnden Künstlern und festen Geldmitteln, aus öffentlicher Hand regelmäßig gefördert, weder innovativ, noch unverantwortlich, noch gefrässig.
Eine öffentliche Finanzierung der Theaterlandschaft in Deutschland stellt meiner Meinung nach eine unverzichtbare finanzielle Grundlage für die Theaterhäuser dar. Von den staatlichen Subventionen hängen nicht nur die künstlerischen Produktionen, sondern auch die Arbeitsplätze vieler Theatermitarbeiter - aus dem künstlerischen sowie aus dem nicht-künstlerischen Bereich - ab. Die öffentliche Finanzierung reicht vielen Theatern schon lange nicht mehr aus. Insofern kann eine Finanzierung wie sie am Beispiel des National Theatre von Herrn Balme dargestellt wurde, als eine Alternative verstanden werden, die den Theatern eine Möglichkeit gibt sich von der öffentlichen Förderung ein Stück unabhängig zu machen, und um seine finanziellen Spielräume zu erweitern.
„Die Reformunfähigkeit des real existierenden Kulturbetriebes ist inzwischen sprichwörtlich, seine Strukturen sind oft undurchschaubar, ebenso wie seine Netzwerke. Manche Einrichtung, manche Stiftung verfolgt keinen klaren kulturellen Zweck, sondern einen unausgesprochenen anderen. Noch immer werden Ressourcen unklar verteilt oder vergeudet. Ohne Idee und ohne Kriterien sind Kulturpolitiker unfähig, das sich ausdehnende Institutionenuniversum zu gestalten, vor allem fehlt ihnen ein Vokabular, einen Rückbau zu kommunizieren, wo er nötig wird.“ (Aus: DIE ZEIT, 22.3.2012 Nr. 13, Thomas E. Schmidt)
Nun gilt es aber, nicht destruktiv alles schlecht zu reden oder Missstände lediglich aufzuzeigen und anzuprangern, vielmehr müssen neue Wege für den Kulturbetrieb in Deutschland gefunden werden. Christopher Balme hat mit seinem Vorschlag des „dritten Wegs“ versucht, einen möglichen Lösungsweg zu formulieren. Zwar sind seine Beispiele gut nachvollziehbar gewesen, allerdings waren sie nicht hundertprozentig überzeugend: Zum einen, weil es um englischsprachige Produktionen ging, die viel einfacher global verkauft werden können, da Englisch von vielen verstanden wird. Zum anderen, weil es wahrscheinlich wirklich One-Hit-Wonder waren. Die Idee, die hinter dem „dritten Weg“ steckt, ist aber sehr verständlich und erscheint sinnvoll. Ich hätte mir gewünscht, dass Balme diese noch mehr ausgeführt und mit mehr Beispielen belegt hätte.
#„Die Chance zum Risiko“ ist mit Sicherheit eine spannende Idee, doch Risiko, wie das Wort schon sagt, beinhaltet auch immer die Gefahr des Scheiterns. Ich habe oftmals erlebt, dass die Klassiker, wie MacBeth, die Zauberflöte oder Ähnliches großen Andrang erlebten. Unbekannte Inszenierungen oder auch moderne Inszenierungen jedoch mussten stark umworben werden um überhaupt das Interesse zu wecken, (Das ist natürlich nicht immer der Fall) was selbstverständlich auch wieder ein finanzielles Input benötigt.
Das Beispiel mit der „Warhorse“ Produktion hätte unter gewissen Umständen auch ein Negativbeispiel werden können. Meiner Meinung nach ist das stark ortsabhängig und sollte man tatsächlich einmal so einen Glücksgriff (und ich denke, so kann man dies nennen) gelandet haben (wie hier der Erfolg des „Warhorse“) so lassen sich daraus noch immer keine Regeln festlegen. Was auf der anderen Seite auch gut ist, denn sonst würde es gar nichts Experimentelles oder nur „nachgespieltes Experimentelles“ geben.
#Natürlich würde durch eine Teilsubventionierung etwas mehr Freiheit gewährt werden, jedoch leidet darunter auch die Sicherheit – sonst wäre es kein Risiko. Aber heute, wo das Theater teilweise nahezu für tot erklärt wird, verstehe ich wenn der Mut zu einem solchen Risiko fehlt.
Es ist faszinierend und traurig, welcher Teufelskreis immer wieder auftaucht.
Das Problem was ich hier sehe ist die heutige Gesellschaft. Es ist leichter das Theatersystem zu ändern als die Gesellschaft, doch ist dies auch der richtige Weg?
Anders gesagt: Der Mensch schafft zwar die Kultur, die Produktion und Weiterentwicklung -sprich die Finanzierung) sollte jedoch automatisiert werden.
Meiner Meinung nach muss ein Plan her, der die Finanzierung aller Theater ermöglicht und nicht zu 85% aus öffentlichen Zuschüssen besteht.
Auch das Theater kann da mal in den sauren Apfel beißen, um an Geld zu kommen.
Wenn wir im Verein (der auch unabhängig und einzigartig ... sein soll) einen Förderantrag für ein anstehendes Projekt schreiben, müssen wir uns meistens auch den Richtlinien der beugen, die uns Geld geben können und gewisse Programmpunkte etc. akzeptieren.
Warum dann kein Konzept aufstellen, was wirklich bei der Masse ankommt und genug Geld einspielt?
Ich glaube auch nicht, dass man sich bei einer richtigen Planung des Konzepts große Fehlspekulationen riskiert.
Dieser Auszug aus "Cultural Industries: a challenge for the future of culture" (1982) umfasst jene (zeitlose) kulturpolitische Einsicht, die insbesondere für den Bereich der kulturellen Bildung heutzutage unumgänglich ist. Lange genug dienten Adornos Theorien als Speerspitze für die Vereinsamung der Künste und dessen Wert. Die auf „nachtkritik“ so gern angewendete polemische Phrase der „Hollywoodproduktionen“ unterstreicht auf paradoxe Weise die gezielte Abgrenzung der Künste von seiner Umwelt und dessen Einbindung, stets auf Berufung Adornos Vorstellung der ausschließlich intellektuellen Annäherung. Wenn man auf das neu gewonnene Bewusstsein der kulturellen Bildung schaut und die damit verbundene Verantwortung gegenüber „Kreativität im Allgemeinen“, sind Balmes Thesen nicht das 1x1 für Kassenschlager, sondern ein Fingerzeig für die zielgerichtete Öffnung der Künste auf einem profitorientierten Markt. Am Beispiel „Warhorses“ wurde deutlich, dass dies ein zukunftweisender Weg sein kann um dem populistischen „Tropf“ (SZ) mit Konzepten entgegen zu treten und nicht mit künstlerischer Engstirnigkeit. Adornos Ansichten sollten nicht der fatalen Überprüfung von „falsch“ und „richtig“ unterzogen werden. Viel wichtiger wäre es, die Kulturindustrie nicht länger als Alibi für rote Zahlen vor sich her zu schieben sondern sich endlich einer „effektiven Partizipation des Volkes“ zu stellen. Wer in diesem Zuge glaubt, „Hollywoodproduktionen“ seien ausschließlich Embryos Jerry Bruckheimers, wandelt weiter auf dem Irrweg, zudem schon bald sehr einsam.