Weitermachen ist mehr, als ich tun kann - Samuel Beckett: Briefe 1929 -1940
Das Wetter ist scheußlich
von Dirk Pilz
Januar 2013. Im August 1932 teilt Samuel Beckett aus London seinem engen Freund Thomas McGreevy mit: "Schon der Gedanke ans Schreiben scheint mir irgendwie lächerlich." Er hat zu dieser Zeit seinen ersten, posthum veröffentlichten Roman "Traum von mehr bis minder schönen Frauen" abgeschlossen, arbeitet an Gelegenheitsübersetzungen, verfasst zuweilen Rezensionen und freut sich, dass ein Jahr zuvor sein langer Essay über Marcel Proust erschienen ist. Das half ihm aus finanziellen Nöten, aber wozu Literatur schreiben? Sein Bruder Frank wird ihn später fragen: "Warum kannst du nicht so schreiben, wie die Leute wollen?" Ja, warum? Beckett antwortete, dass er nur "auf die eine Art" schreiben könne – und fand, dass dies "überhaupt nicht die richtige Antwort" sei.
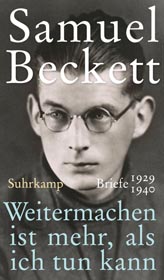 Er hat lange gesucht nach einer Antwort, sehr lange. Der Proust-Essay fiel für ihn unter die Abteilung "meine kleinen Seelenschisse". Aber auch das war mit Nöten verbunden. "Den Proust anzufangen schaffe ich nicht", lässt er im Juli 1930 McGreevy wissen; drei Wochen danach gesteht er, noch kein Wort zu Papier gebracht zu haben. "Du weißt, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Der einfachste Satz schon ist Folter." Ist das kokett? Eine Pose? Ist es nicht, wie aus den jetzt auf Deutsch erhältlichen Briefen Becketts der Jahre 1929 bis 1940 zu erfahren ist.
Er hat lange gesucht nach einer Antwort, sehr lange. Der Proust-Essay fiel für ihn unter die Abteilung "meine kleinen Seelenschisse". Aber auch das war mit Nöten verbunden. "Den Proust anzufangen schaffe ich nicht", lässt er im Juli 1930 McGreevy wissen; drei Wochen danach gesteht er, noch kein Wort zu Papier gebracht zu haben. "Du weißt, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Der einfachste Satz schon ist Folter." Ist das kokett? Eine Pose? Ist es nicht, wie aus den jetzt auf Deutsch erhältlichen Briefen Becketts der Jahre 1929 bis 1940 zu erfahren ist.
Aber es sind diese Schreib- und Selbstklagen, die das öffentliche Bild Becketts prägen. Bis heute, gerade auch in den Dramaturgen-, Feuilleton- und Akademikerstuben offenbar. Beckett, der Schwarzseher, Beckett, der Verstummer, der Zu-Ende-Bringer, der Griesgram, der Schweiger, der Verächter jeder Leichtliteratur. Im März 1934 schließt er einen Brief an seinen zwölf Jahre älteren Cousin Morris Sinclair mit dem Wunsch, "die Zukunft möge ein Höchstmaß an Wohltuendem und Günstigem (bringen), in einer Welt, in der diese Tugenden immer seltener zu werden scheinen". Das ist der Beckett, wie ihn der Kultur- und Theaterbetrieb gern hat: ein Mann, der von einer Welt erzählt, in der Begriffe wie Gunst und Wohl Fremdworte sind.
Für die Verdauung
Das allerdings ist ein Boulevard-Beckett. Der Mensch Beckett war sehr redselig, sehr weltzugewandt, sehr streitfreudig und mit der Fähigkeit zum beißenden Witz gesegnet. Als er sich von verschiedenen Verlagen für seinen Roman "Murphy" lauter Absagen einhandelt, schreibt er kurz vor Weihnachten 1936 aus Berlin an McGreevy: "Zum Buch nichts Neues. Das letzte war meine Bereitschaft, den Text bis auf den Titel zu kürzen und ihn zu ändern, falls er Anstoß erregt." Oder aber, auch das ein schöner, bislang noch nicht umgesetzter Vorschlag Becketts, man möge den Roman unter dem Label "Beckett's Bowel Books" (Becketts Verdauungsbücher) als Klopapierrolle herausbringen: "Mein nächstes Buch wird auf Reispapier gedruckt, auf eine Spule gewickelt, alle sechs Zoll mit einer Perforation versehen und bei Boots verkauft. Die Länge der Kapitel wird sorgfältig auf die durchschnittliche Entleerung abgestimmt."
Keiner sage, Beckett habe es an Humor gemangelt. Das konnte allerdings bereits wissen, wer die Biografien von James Knowlson (2001) und, besser noch, von Deidre Bair (1978) gelesen hat. Und dass seine Literatur kein schnöder Götzendienst auf den Altaren eines weltbejammernden Nihilismus ist, schon gar keine pathosselige Feier eines nebulösen Absurden oder seufzenden Vergeblichen, ist bestens bei Beckett selbst nachzulesen, vor allem in seinen Romanen; in "Der Namenlose", vielleicht sein bestes, gehaltvollstes Buch, hat er für derlei pseudoliterarische Turnübungen an den Geräten des Fatalismus den treffenden Spottbegriff "Verzweiflungsgymnastik" erfunden. Sich damit aufzuhalten, schien Beckett nicht wert.
Ein Loch nach dem anderen
Er suchte vielmehr nach einer Sprache, die sich den gewöhnlichen Verbiegungs- und auch Verblendungstendenzen des Sprechens entzieht, die erkunden, herausbringen will, wie ein enthimmeltes, götterfreies Leben sich anfühlt, wie es möglich – oder nicht möglich ist. In einem berühmt gewordenen Brief an Axel Kaun vom Juli 1937, Mitarbeiter beim Rowohlt Verlag, spricht er vom "Schleier" der Sprache, der "zerrissen" werden müsse: "Ein Loch nach dem andern in ihr zu bohren, bis das Dahinterkauernde, sei es etwas oder nichts, durchzusickern anfängt". Er will, dass das Sprachgewebe "porös" wird; die bereits damals beginnende Mode, dies in Zusammenhang mit der Literatur von James Joyce zu bringen, kommt ihm, zu recht, dabei sinnlos vor. Beckett suchte etwas, das er nirgends fand seinerzeit.
Es ist kein Zufall, keine bloße Äußerlichkeit, dass er in diesen Jahren zwischen seiner Geburtsstadt Dublin, London, Paris und Deutschland herumirrt, auf Englisch, Deutsch und Französisch schreibt – um am Ende Paris und das Französische zu seiner literarischen Heimat zu machen. Es sind diese vielen schwierigen Wege zu seinem Literatur- und Sprachverständnis, die in den Briefen des jungen Beckett nachzulesen sind.
Der vorliegende Band ist der erste Teil einer auf vier Bänden angelegten Ausgabe seiner Briefe, eine Auswahl von ca. 2500 Briefen aus den insgesamt 15000, die er bis zu seinem Tod 1989 schrieb, ausführlich kommentiert, sorgfältig herausgegeben. Dass es die Briefe erst jetzt gibt, lässt auf extrem komplizierte, mit allerlei Engstirnig- und Eitelkeiten durchsetzten Streitigkeiten bei der Auswahl schließen. Wer sich von diesen Grabenkämpfen ein Bild machen will, lese die Einführung – und die Danksagung; sie umfasst 12 Seiten.
Geblöke, Gewieher
Beckett hat bereits 1985 sein Einverständnis erklärt, dass man nach seinem Tod die Briefe veröffentliche. Nun darf man sie lesen und viel daraus lernen. Man lernt ihn als genauen Leser und scharfen Kritiker kennen; Goethes "Faust 1" – "eine überraschende Menge an Belanglosigkeiten"; Wilhelm Furtwängler dirigiert Beethovens 7. Symphonie – und die Blechbläser "blasen, wie es nur Biersäufer fertigbringen". Man staunt, dass er im Winter 1936/37 durch Nazi-Deutschland reist, in Berlin wohnt, in Hamburg, Dresden, München, Bamberg ist, aber von überall vor allem von Bauwerken, Bildern und Büchern berichtet, viel über Musik spricht, von der Familie, seinen Krankheiten (Zysten, Rippenfellentzündungen, Herzrasen) und Geldsorgen. So gut wie nichts über Nazis, Politik, Kriegsgefahr. "Das Wetter ist scheußlich", vermeldet er aus Hamburg, mehr ist von den äußeren Umständen kaum zu erfahren.
Aber es hieße der Küchenpsychologie Kränze flechten, nähme man diese Briefe geradewegs als Seelenentblößungen, als direkte Wege ins Beckett-Innere. Aus Berlin teilt er einmal der Schriftstellerin Mary Manning Howe mit, dass sich bei ihm "zwischen Wind und Wasser" (im Hodenbereich) ein "großer Klumpen" gebildet habe und die letzte Woche darum im Bett verbracht wurde, "von einem, von dem ich erst jetzt allmählich begreife, dass ich es bin". Auch das zu begreifen und zu beschreiben war für Beckett kein psychologisches, kein privatseelisches, es war ein sprachliches Problem, vor allem ein sprachliches, rhythmisches, tonlagenmäßiges.
Er wusste früh, dass er mit solcher Literatur "irritiertes Geblöke & Gewieher provozieren" werde, und er wusste, dass sie sich an kein Ende, zu keiner kristallinen Geschlossenheit führen lässt: "Die Symphonie unvollendet zu lassen, das ist jedenfalls die Hauptsache."
Samuel Beckett:
Weitermachen ist mehr, als ich tun kann.
Briefe 1929 – 1940.
Herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck. Für die deutschsprachige Ausgabe übersetzt und eingerichtet von Chris Hirte.
Suhrkamp, Berlin 2013, 856 S., 39,95 Euro
Weitere Buchrezensionen sind hier zu finden.
mehr bücher
meldungen >
- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral
- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"
- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben
- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant



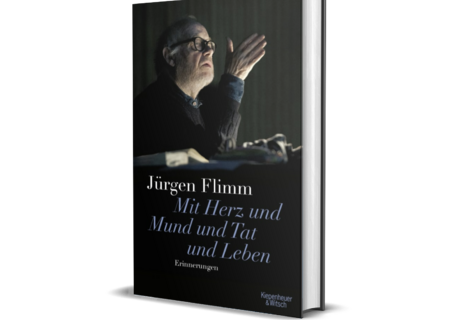









neueste kommentare >