Tolstoi. Licht und Finsternis - Lars-Ole Walburg inszeniert am Schauspiel Hannover einen Abend nach Tolstoi
Von unten wie von oben
von Simone Kaempf
Hannover, 9. Februar 2013. Der Gutsbesitzer Graf Lew, der ein ganz normaler Mensch sein möchte, nimmt die Axt irgendwann selbst in die Hand. Mit jedem Schlag in den Holzstamm fliegen Splitter über die Bühne. Jedesmal hebt sein Knecht zum Schutz die Arme, und bald ist der Teppich im guten Wohnsalon berieselt, in dem sich Frau und Schwägerin schon kräftig mit Worten gewehrt haben gegen das Familienoberhaupt, das nicht nur anpackt – ungeschickt, aber umso entschlossener –, sondern auch sonst Ernst damit macht, die bestehende Ordnung anzutasten: Seinen Reichtum mag er nicht mehr, Ausbeutung gehört abschafft, kirchlichen Segen verwehrt er, und seine Ländereien würde er zum Entsetzen der Familie am liebsten den armen Bauern verschenken.
Unerträgliche Widersprüche
Diese Holzhackszene lässt sich der Schauspieler Mathias Max Herrmann nicht entgehen, um für den Reformeifer seiner Figur noch ein paar Lacher und Sympathiepunkte zu gewinnen. Was gar nicht nötig wäre, denn dieser Graf Lew ist sowieso mit Abstand die wahrhaftigste Figur dieses Abends, und er hat es nicht nur mit einer, sondern zwei schwierigen, erstarrten Gesellschaften zu tun, die vom Bühnenbild zu Lars-Ole Walburgs Inszenierung streng hierarchisch gedacht sind. Oben in dem zweigeteilten Bühnenbild bewegt man sich im Wohlstand auf glänzendem Parkett. Unten siecht die Unterschicht geduckt in Sperrmüllmöbeln dahin. Der Bauer ist todkrank, seine Frau Anisja tauscht ihn bald gegen den Knecht Nikita aus, den sie mit Geld an sich hält. Ein weiterer Mord geschieht, bis dann Nikita sein Unglück erkennt und durch Reue Einhalt gebietet.
 Oben edles Plastik, unten billiges Sperrholz © Katrin Ribbe
Oben edles Plastik, unten billiges Sperrholz © Katrin Ribbe
Walburg hat sich nicht begnügt mit Tolstois Bauerndrama "Die Macht der Finsternis", das in jüngerer Zeit von Sebastian Baumgarten (Nachtkritik hier) und Michael Thalheimer (Nachtkritik hier) inszeniert wurde. Das Stück ist in Hannover um "Und das Licht leuchtet in der Finsternis" ergänzt, in dem jener reiche Gutsbesitzer Graf Lew seinen Besitz aus moralischer Überzeugung verschenken will, aber auf den erbitterten Widerstand seiner Familie stößt.
Auf der oebereen Bühne wird das eine Stück gespielt, unten das andere. Der Clou dieser Verzahnung offenbart sich am stärksten im Bühnenbild: Die Parallelität beider Milieus zeigt, dass sich die Sünden der Liebe und des Geldes willen überall türmen, dass sie vor sozialen Grenzen nicht Halt machen. Folglich übernimmt Susana Fernandes Genebra sowohl die Rolle der betuchten Sofia, die mit ihrem Mann eloquent ums Finanzielle streitet, als auch die der derb fluchenden Anissja, die ihrem Mann des Geldes wegen das Gift mischt. Und Beatrice Frey gibt einerseits oben die gluckenhaft moralisch Fürstin, andererseits unten die Garstigkeit befeuernde Knechtsmutter. Oben hält man feinsinnigen smalltalk, wie Kunst die Welt besser macht, unten schlägt man sich, um dem Toten als Erster das Portemonnaie vom Halsband zu ziehen. Und dann ist da noch die Lichtgestalt, die Mathias Max Herrmann als Lew abgibt. Ein Widerständler, der sich als einziger hinab zum Volk begibt und dann vorne an der Bühne eine kleine Brandrede darüber hält, "dass er die Widersprüche einfach nicht mehr ertragen kann". Dafür erhält er vom Publikum kräftig Szenen-Applaus.
Ein Verwandter der Volksfeinde
Wenn er von Widersprüchen spricht, könnte er aber auch sein eigenes Seelenleben meinen: die Diskrepanz zwischen seiner moralischen Überzeugung und der persönlichen Unzulänglichkeit, die ihn daran hindert, dass er seinen Besitz wirklich den Bauern übergibt und die sein Aufstandspathos bald melancholisch verstummen lässt. Genau weiß man es aber nicht. Denn trotz des schönen Settings und trotz des Willens zur Analyse hat der Abend von Lars-Ole Walburg dann doch etwas ziemlich Harmloses.
Die besseren Gutshofbewohner werden anfangs teetassenkreisend vorgestellt, so dass man schon denkt, Walburg will auf eine Satire hinaus. Mit ihren Perücken und ihrem allzu rotzigen Ton erstarren die Unterschichtler ihrerseits in einer Künstlichkeit ihrer Milieu-Darstellung – samt seltsam realistischer Einsprengsel, wenn etwas Nikita und Akulina aus der Stadt einen neonpinken Slip mitbringen. Graf Lew baut in einer Szene Plastikstühle im Salon wie für einen Schulunterricht auf, aber ein didaktisches Lehrstück wird dann doch nicht draus. Dazu wird zuviel moralisiert und zu langatmig erörtert, statt Mechaniken aufzuzeigen.
In den Empathie erzeugenden, knisternden Momenten, in denen Mathias Max Herrmann vorne an der Rampe plädiert, nicht mehr auf Kosten anderer zu leben, fühlt man sich ein wenig an das Prinzip der beiden Berliner Volksfeind-Inszenierungen (von Jorinde Dröse, Nachtkritik hier und Thomas Ostermeier, Nachtkritik hier) erinnert. Und doch: aufrührerisch will der Hannoveraner Abend einfach nicht werden. In der Auflehnung gegen die Ungerechtigkeit packt Walburg den Tolstoi-Stoff, um ihn für die Gegenwart schlüssig zu machen. Und der Regie-Wille, die Bühne groß zu füllen, ist deutlich spürbar und sympathisch. Aber der Spagat zwischen Milieu-Beschreibung und Seelen-Drama ist zu groß, das Theaterspielen so offensichtlich. Die Botschaft bleibt – im luftleeren Raum.
Tolstoi. Licht und Finsternis
nach Lew Tolstoi
Regie: Lars-Ole Walburg, Bühne: Kathrin Frosch, Kostüme: Nina Gundlach, Musik: Lars Wittershagen, Dramaturgie: Christian Tschirner.
Mit: Mathias Max Herrmann, Susana Fernandes Genebra, Mirka Pigulla, Elisabeth Hoppe, Rainer Frank, Beatrice Frey, Jakob Benkhofer, Philippe Goos, Wolf List, Thomas Neumann.
Dauer: 2 Stunden 30 Minuten, eine Pause
www.schauspiel-hannover.de
Ermöglicht durch:
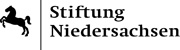
Alle Texte des Niedersachsen-Schwerpunkts hier.
Lars-Ole Walburg nehme Tolstois Texte "so ernst, wie man es lange nicht mehr auf der Bühne gesehen hat", befindet Alexander Kohlmann vom Deutschlandfunk (Kultur heute, 10.2.2013). Die Schauspieler spielten "ganz nahe dran am Text", was angesichts vorhergehender Walburg-Abende "wohltuend und überraschend" sei: "Keine Witze, keine Slapstickeinlagen und keine offene Umzüge stören die Konzentration auf die beiden Texte". Statt auf "ästhetische Mittelschau" setzte der Regisseur "auf die Konfrontation Tolstois mit sich selbst, lässt die eitlen Reden Lews angesichts der brutalen Realität im Bauerndrama ins Leere laufen". Die Ratlosigkeit des alten Grafen Lew am Ende "auszuhalten und mit der Kombination der beiden Texte offenzulegen ist die beklemmende Leistung dieses Abends".
Nicht alle Doppelbesetzungen in Walburgs Oben-Unten-Konzept leuchten Anke Dürr von der Frankfurter Rundschau (11.2.2013) ein, "wie überhaupt wenig Beziehung zwischen den beiden Stücken entsteht. Das Drama, dass die Bauern, denen Graf Lew sein Land schenken will, leider moralisch arg verkommen sind", bleibe ebenso auf der Strecke wie "die Parallele, dass die Macht des Geldes oben wie unten menschliche Beziehungen zerstört". Auch "ob die wenig variierte Spielweise der Schauspieler als Adelige wie als Bauern (...) etwas bedeuten soll oder nur unpräzise ist", erschließt sich der Kritikerin nicht. Dass Graf Lew als "larmoyanter Öko-Spießer" dargestellt werde, zeige überdies kaum "die Zerrissenheit zwischen Denken und Handeln" und sei "auf Dauer auch ganz schön öde", obwohl er doch "eigentlich existenzielle Fragen" nach dem richtigen Leben und den Zwängen im Kapitalismus aufwerfe.
"Intelligent und unterhaltsam" hat Walburg die beiden Dramen nach Ansicht von Ronald Meyer-Arlt in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (11.2.2013) kombiniert, "das Neben- und Miteinander" funktioniere hervorragend. Die "flirrende Künstlichkeit des Anfangs" sei schnell vorbei, "was aber vielleicht auch gar nicht schlecht ist". Dieses "Spiel vom guten Menschen" entwickle "durchaus eine gewisse Wucht", vor allem weil sich hier "zwei der vornehmsten Aufgaben des Theaters" berührten: "den Zuschauern die moralische Frage nach dem richtigen Leben zu stellen und ihnen gute Schauspieler zu präsentieren". Auch die "Schnellverwandlungen" der Schauspieler überzeugen den Kritiker: "Oben säuseln, unten keifen – aber alles von großer Glaubwürdigkeit. Chapeau!" Das "Verstellungstheater macht Spaß, denn es ist mit leichter Hand inszeniert". Insgesamt: "sehr schön".
Einiges in Graf Lews Monologen klingt für Evelyn Beyer von der Neuen Presse (11.2.2013) "absurd aktuell". Mathias Max Herrmann gebe ihm "großartig auch die unbequemen Zwischentöne mit". Die Figurenführung Walburgs findet die Kritikerin "bestechend genau", er lasse "ironisieren, an der Groteske langbalancieren" und durchsetze "das trockene Thesendrama oben sarkastisch mit bewusst billigen Wiltzen". Dazu "tolles Spiel in allen Rollen". Das Stück schwäche sich jedoch "mit seinen beiden Ebenen gegenseitig. Thesen und Groteske, Sozialdrama und Psychospiel - wo immer man eintaucht, man ist gleich darauf rausgerissen." Fazit: "Spannend sind Experiment und Ergebnis allemal. Aber unter die Haut gehts nicht."
Nicole Korzonnek von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (12.2.2013) hingegen vermag Walburgs "Szenensplitterkonglomerat" in keiner Weise zu überzeugen. Für sie haben das Bühnen-Oben und das -Unten außer der Doppelrollen nicht viel "miteinander zu schaffen". "Berühren tun sich beide Stücke im Kern indes nicht, sondern laufen als lieblos zerstückelte Szenenabfolge konsequent aneinander vorbei." Eine Gemeinsamkeit gebe es immerhin: "beide Männer werden in beiden Dramen von Walburg ideologisch kastriert. Walburg nimmt beiden ihr Gottvertrauen und opfert es auf dem Altar des Anti-Religion-Mainstreams." Das alles gehe "kilometerweit an dem vorbei, was der große Russe mit seinen noch größeren Ansprüchen und größten Überzeugungen eigentlich sagen wollte. Und zwar oben wie unten. Deswegen zwingt sich ganz zum Schluss eine Gegenfrage auf: Ist das noch Tolstoi, oder kann das weg? Es kann weg."
Für sehr gelungen hält Marius Nobach von der Süddeutschen Zeitung (15.2.2013) diesen zweiteiligen Tolstoi-Abend. Mit "bemerkenswerter Konsequenz" verfolge Walburg besonders, wie der Weltverbesserungsenthusiasmus des Protagonisten langsam "der Einsicht weicht, dass sein Streben nach einer gerechteren Ordnung an den Unzulänglichkeiten der Gesellschaft wie auch der eigenen Persönlichkeit scheitern wird". Dabei beweist Walburg aus Sicht des Kritikers "den Mut, dem Zuschauer keine Alternativlösung anzubieten – dieser wird mit der gleichen ernüchternden Ratlosigkeit konfrontiert."
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.
mehr nachtkritiken
meldungen >
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral






















neueste kommentare >