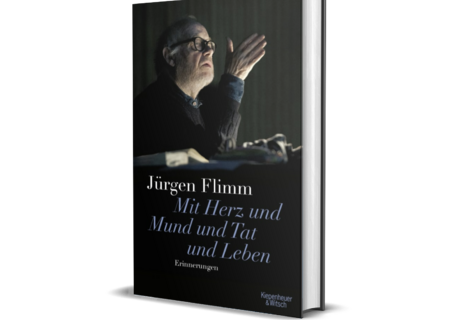Rahel Jaeggi - Kritik von Lebensformen
Wir haben ein Problem
von Dirk Pilz
Berlin, 19. Februar 2014. Das Ende der großen Erzählungen ist längst vorbei. Noch immer gilt zwar den meisten als ausgemacht, dass nicht länger gegeben ist, was lange den Menschen Heimat und Geborgenheit verschaffte, sie aber auch einengte und ängstigte, wenn nicht entmündigte, nämlich eine verbindende, Gemeinsamkeit stiftende, die Unterschiede und Individualitäten überwölbende Welt-, Fremd- und Selbstwahrnehmungssicht. Mit den Göttern starb auch die Gemeinschaft der Seelen. Wir haben keine gemeinsame Großerzählung mehr, wir sind Verwickelte in einem Netz von Einzelgeschichten.
Aber das stimmt nicht. Nicht nur, weil auch das der Struktur nach eine alle verbindende Erzählung ist. Sondern weil unbezweifelbar, felsenfest sicher scheint, dass die kapitalistische Ordnung eine alles beherrschende ist, die jede und jeden das entsprechende Dasein diktiert. Es gibt keine Alternative, wir sind alle Kapitalisten.
Das ist der Konsens. Man trifft ihn allerorten, man lese, zum Beispiel, die Beiträge zur Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de – so unterschiedlich die Überlegungen und Schlussfolgerungen etwa von Matthias von Hartz und Bernd Stegemann oder zuletzt Ulf Schmidt sein mögen: Sie setzen diese eine Großerzählung von der Alternativlosigkeit der herrschenden Ordnung voraus. Wie auch nicht. Es findet sich kein Außerhalb. Daraus lässt sich zwar keineswegs schließen, dass es dieses schlicht nicht gibt, aber es zeigt sich nicht, allenfalls theoretisch.
Meine Sache
Diese Großwetterlage provoziert zwei inzwischen gut eingeübte Reaktionen, die je verschieden kritisch sein, also eine Differenz setzen wollen. Entweder den oft ressentimentgeladenen Rückzug auf ein Privates, gern in Verbindung mit einem kulturkritischen Gestus, beispielhaft zu studieren anhand der Schriften von Botho Strauß.
Oder aber den Ruf danach, "noch einmal von vorn anzufangen", also "das Ganze" in Frage zu stellen, ein Gedanke, den zum Beispiel Milo Rau mit seinem polemischen Essay Was tun? durchspielt. Ob es das Private (noch) gibt und ein Ganzes überhaupt zu ermitteln ist, sei dahingestellt. Allerhöchst begründungspflichtig ist jedoch die in beiden Fällen gemachte Annahme, dass der archimedische, jenseits des Geschehens beheimatete Punkt sich erfassen lässt, den es braucht, wenn denn die Rede vom Privaten oder Ganzen irgend Sinn ergeben soll. Zudem wird damit so etwas wie ein von vornherein feststehendes Ziel der Kritik (oder der Geschichte) behauptet, das es herzuleiten, zu begründen und inhaltlich zu füllen gilt; andernfalls bleibt das Private und Ganze, was es zumeist ist: bloße Phrase, verkümmert zur Pose.
Bislang wurden, so weit ich sehe, die hierfür erforderlichen Begründungen nicht erbracht. Damit verlieren beide Weisen ihr kritisches Potenzial – sie scheinen lediglich unterschiedliche, der Subjektivität überantwortete Spielarten im Umgang mit der gesellschaftlichen, politischen, sozialen Situation zu sein. Einen Unterschied machen sie nicht – wir sind wieder dort, wo der Konsens uns verortet: Der Kapitalismus ist nicht nur ohne Alternative, er entzieht sich jeder Kritik, eben weil es keinen Ort gibt, von dem aus sie denkbar wäre. Wie ich lebe und was ich hoffe: meine Sache.
Unser Leben
An diesem Punkt kommt die Berliner Philosophin Rahel Jaeggi ins Spiel. Sie versucht etwas Unerhörtes. Sie nimmt an, dass mein Leben und Arbeiten nicht nur meine Sache ist. Dass eine Kritik von Lebensformen nicht nur möglich, sondern unausweichlich ist. Über Lebensformen lasse sich, sagt sie, streiten, und zwar mit Gründen. Sie wendet sich damit ausdrücklich gegen eine liberale Neutralität angesichts des "Faktums der Pluralität", wie sie von John Rawls behauptet wird, und gegen jene ethische Enthaltsamkeit, die Jürgen Habermas geboten sieht.
Rahel Jaeggi sagt in ihrer dem Denken Bahn brechenden Studie dagegen, dass Lebensformen durchaus eine kritisierbare Größe sind. Und sie hat dabei immer konkrete Fälle im Blick, die Frage nach der Berechtigung von Ehrenmorden, der Züchtigung von Kindern oder der bürgerlichen Familie etwa.

Den Verdacht, dass sie einer Sittenpolizei oder dem Paternalismus in die Karten spiele, kann Jaeggi rasch ausräumen. Es geht ihr (zunächst) nur um den Nachweis, dass Lebensformen zwar nicht frei gewählt und in diesem Sinne gegeben, zugleich aber immer von Menschen gemacht sind. Ethische Enthaltsamkeit führe deshalb dazu, dass Lebensformen "unsichtbar", also "zu einer Schicksalsmacht renaturalisiert" und folglich jeder Kritik entzogen werden.
Für Jaeggi sind Lebensformen aber gemeinsame, geteilte und "komplex strukturierte Bündel sozialer Praktiken, die darauf gerichtet sind, Probleme zu lösen, die ihrerseits historisch kontextualisiert und normativ verfasst sind". Lebensformen: "Problemlösungsinstanzen". Sie reagieren auf Probleme, die sich dem Menschen in Bezug auf die Gestaltung, nicht nur die Sicherung, des Lebens stellen. Entsprechend machen sie geltend, dass sie die jeweils angemessene Lösung für das Problem sind. Das Gelingen von Lebensformen lässt sich deshalb auch daran messen, ob sie diesem Anspruch genügen oder nicht.
Zusammenhänge herstellen
Jaeggi verwendet viel Mühe darauf, ihren Begriff der Lebensform, der Probleme und Krise, der Normativität und Ethik zu klären. Im Einzelnen mag man mit ihr streiten (die Dynamik von Krisen und der Status von Problemen wäre, meine ich, mit Charles Sanders Peirce und Ulrich Oevermann treffender als mit Alasdaire MacIntyre und John Dewey zu erfassen), aber ihr präzise entwickeltes Konzept einer immanenten Kritik erweist sich als überaus fruchtbar.
Es geht immer von "gegebenen Kontexten und den in der Sache liegenden Maßstäben" aus. Sie tritt, sagt sie mit ausdrücklichem Verweis auf Marx, "nicht mit einem vorgefertigten Ideal der Wirklichkeit entgegen", sondern entwickelt dieses Ideal aus dem widersprüchlichen "Bewegungsmuster der Wirklichkeit" selbst. Kritik ist dabei stets ein "Verfahren, Zusammenhänge herzustellen", im besten Hegelschen Sinne demnach dialektisch. Und diese Kritik von Lebensformen initiiert nach Jaeggi einen Lernprozess, ohne ein vorgegebenes Lernziel und ohne eine Alternative am grünen Tisch zu entwerfen.
Das macht es auch möglich, von misslingenden Lebensformen zu sprechen, sie leiden "an einem kollektiven praktischen Reflexionsdefizit, an einer Lernblockade". Sie sind, ließe sich mit Bezug auf Jaeggis schon vor neun Jahren erschienenen Abhandlung zur "Entfremdung" sagen, Ausdruck einer defizitären Beziehung zur Welt und zu den Anderen, eben entfremdet, sich selbst nicht entsprechend.
Es ist nicht gut, wie es funktioniert
Man sieht daran, warum der Rückzug auf das Private oder der Vorgriff auf ein Ganzes kaum gelingende Lebensformen abgeben können: In beiden Fällen treten die daran geknüpften sozialen Praktiken als ein "unhintergehbares Letztes" auf, in beiden Fällen ist, grob genommen, der Kapitalismus keine kritisierbare Größe mehr, sondern eine Schicksalsmacht. Als solche kann sie tatsächlich entweder nur "als Ganzes" abgelehnt oder sich in ihr wie privatistisch auch immer eingerichtet werden. Man verfehlt so jedoch, mit Jaeggi gesprochen, das Problem: Den Kapitalismus gibt es nicht als Naturtatsache, es gibt ihn in unseren Lebensformen.
Man sieht daran auch, dass der Ruf nach anderen Arbeits- und Lebensformen innerhalb und rund um das Theater folgenlos verhallen muss, wenn er nicht konkret, nicht problemorientiert ist. Dass die Stadttheater immer mehr neoliberale Arbeitsweisen befördern und verlangen, dass sie zugleich ihrem Anspruch, die Gesellschaft zu repräsentieren, nicht mehr gerecht werden (siehe die Debatte um Blackfacing, siehe auch die Debatte um das Gorki-Theater), dass es statt Ort der Kunst zum Wettkampfplatz um Aufmerksamkeit zu mutieren droht – das sind so gesehen Phänomene einer Lernblockade. Die Theater reproduzieren Lebensformen, die ihre Gelungenheit verloren haben und blockieren wider Willen den notwendigen Lernprozess.
Man kann Rahel Jaeggis Untersuchung nicht hernehmen und in ihm nach Lösungen wühlen; es gehört weder ins Genre der Lebens- noch der Unternehmensberatung. Aber man kann mit ihm lernen, die Probleme zu situieren und die Lebensformen zu kritisieren. Das ist der Anfang, alles weitere ergibt sich aus dem Lernprozess selbst. Der Anfang, das heißt: deutlich und einsehbar machen, warum etwas nicht gut funktioniert und warum es nicht gut ist, wie es funktioniert. Heißt auch: begreifen, dass wir uns in unseren Lebensformen zwar auskennen, sie selbst aber nicht kennen.
Für das Kennenlernen ist Jaeggis Buch unerlässlich.
Rahel Jaeggi:
Kritik von Lebensformen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014,
451 S., 20 Euro
Alle Buchbesprechungen hier.