Seelandschaft mit Pocahontas (UA) - Das Schlosstheater Celle gratuliert Arno Schmidt zum 100. Geburtstag mit der Erinnerung an eine zeitlose Liebesgeschichte
Rattatá!
von Jan Fischer
Celle, 2. Mai 2014. "Seelandschafft mit Pocahontas" muss man im Zug lesen, das ist der Rhythmus: dieses Rattatá, ein ICE, der mit Höchstgeschwindigkeit durch Sprachebenen und die Niedersächsische Ebene knallt, der Refrain des Zuges, des Buches, bei Schmidt auch der Refrain des Krieges, und im Schlosstheater Celle das Geräusch der Schreibmaschine, auf der der alte Autor tippt, der eigentlich Friedhelm Ptok heißt und einsam vorne am Bühnenrand darauf einhackt, an seinem Tisch im Scheinwerferlicht sich in der Helligkeit suhlt und in den Erinnerungen an eine flüchtige Liebe.
Ständig dieser Krieg
Anfangs stehen sie da zu zweit: Erich und Joachim, Rücken an Rücken, in Uniformen, mit Maschinengewehren in rotem Licht, ihre Münder formen dieses Rattatá, dann ist das vorbei, es geht schnell in Celle, Schmidts Sterbeort: Kulissenteile werden runtergefahren und wieder hochgezogen, der Rhythmus des Stückes versucht, sich dem schnellen Rattatá des Texte anzupassen. Alles ist ein wenig windschief, sieht nach 50er-Jahren aus, eine veraltete Bierwerbung, Haltestellenschild, wie es sie so längst nicht mehr gibt.
 Liebende in fotografischer Landschaft: Stefanie Lanius und Jörn Hentschel © Jochen Quast
Liebende in fotografischer Landschaft: Stefanie Lanius und Jörn Hentschel © Jochen Quast
Die Kulissen werden zu einem Zug, in dem Joachim fährt, an der Schreibmaschine begleitet vom alten Autor, die Bühne wird zu einem Lokal, in dem der alte Autor Getränke serviert, Erich, der erfolgreiche, robuste Malermeister und Joachim, der von Jörn Hentschel spakelig interpretierte und notleidende junge Autor treffen sich zum ersten Mal seit dem Krieg wieder. Sie fahren zusammen in den Urlaub, an einen See, und sprechen vom Krieg, die Kulisse wird ein Hotel, der See, der nichts ist als ein aufgespanntes blaues Seil, ständig dieser Krieg, selbst als Joachim sich verliebt, gibt es kaum ein anderes Thema: die blonde Selma, Pocahontas nennt er sie, Stefanie Lanius heißt sie, die tollpatschig und bohnenstangig über die Bühne stakst.
Autoren, die nicht über sich hinwegkommen
Es gibt eine Textstelle, Erich sagt sie, irgendwo in dem sperrigen, motivdichten Text, und Thomas Henniger von Wallersbrunn legt, Aal essend (ständig wird gegessen und getrunken in der Inszenierung, von leeren Tellern und aus leeren Gläsern), die ganze Schmierigkeit des Aufreißers Erich hinein: Wer den Krieg nicht erlebt hat, der hat nichts zu sagen. Das ist Arno Schmidts Text, diese Generation Autoren, die es nicht mehr gibt, die es nicht geschafft hat, über sich hinwegzukommen wie Joachim auch nicht über seine Pocahontas hinwegkommt. Die beiden stehen auf der Bühne, in dem See, in einer projizierten Pappelallee und küssen sich zaghaft, während der alte Autor sich das ansieht, Szene für Szene.
 Ex-Soldaten am See: Jörn Hentschel und
Ex-Soldaten am See: Jörn Hentschel und
Thomas Henniger von Wallersbrunn
© Jochen QuastDas wichtigste in der Celler Inszenierung ist die Erzählinstanz, der alte Autor, der auf die Geschichte zurückblickt. Bei Schmidt gibt es diese Erzählinstanz nicht, manchmal kommentiert der alte Autor, manchmal greift er ein, manchmal steht er vorne an der Bühne, während hinter ihm der Vorhang heruntergelassen ist. Manchmal liest er einfach nur aus der Buchvorlage vor, manchmal holt er sogar Material von außen in das Stück: Ein Zitat aus der Anklageschrift gegen Schmidt, beispielsweise, "Seelandschaft mit Pocahontas" brachte dem Autor eine Anklage wegen Pornographie ein. Er verliest die Anklageschrift während der Sexszene und verhindert sie so: Joachim verlässt wutentbrannt die Bühne.
Foto=Text=Einheiten
Der wichtigste Eingriff des alten Autor ist aber aus einem Essay Schmidts über Erinnerung, "Erinnerung", sagt Arno Schmidt, sagt der alte Autor, sagt Ptok, sei Gemisch von "Foto=Text=Einheiten", helle Bilder, von kommentierendem, kontextualisierendem Text angereichert. Es wird klar: Selma, Joachim, Erich und seine Annemarie: das sind in Celle alles nur alte Fotos, die nochmal kurz in diesem atemlosen Rhythmus leuchten, verblassen, nirgends hinführen: Joachim stellt Selma unter einem Haltestellenschild ab, eine letzte Zigarette, es ist nur eine Novelle, nur eine Episode, nur ein Stück, das Arno Schmidts Text ganz dicht an sich heranholt. Aber, und das tut die Figur des alten Autors in Celle, auch weit von sich weg hält: Joachim fotografiert die ganze Zeit, am Ende übergibt er die Kamera dem alten Autor.
Kalle Kubiks Inszenierung kommt nicht über diesen leicht staubigen 50er-Jahre Muff hinweg – mit dem Erzähler schafft sie aber soviel Distanz, dass sie den Muff gleichzeitig in diesem Bühnenbild zelebrieren kann, in Kulissen, die so atemlos wie der Text hoch- und wieder runterfahren. Sie zelebriert den Muff des Textes, in dem alte Moralvorstellungen genauso holzig und splitternd aufbrechen wie er ist. Aus Schmidts Liebesgeschichte mit Kriegstrauma wird in Celle die Erinnerung an eine Liebesgeschichte, an der der Krieg auch mal so ein bisschen vorbeigeht. In Celle, wo man derart Schmidts 100. Geburtstag feiert, geht es um die Flüchtigkeit der Liebe und der Erinnerungen, und das ist tatsächlich rund und interessant, ist auf seine eigene Art langsam inszeniert und knattert trotzdem ohne Atem dahin, das ist dicht und durchdacht, und der Muff, der soll so sein, und in der Erinnerung ist alles immer schöner und auch trauriger. Rattatá.
Seelandschaft mit Pocahontas
von Arno Schmidt
Inszenierung: Kalle Kubik, Mitarbeit Regie: Bernd Rauschenbach, Bühne und Kostüme: Manfred Breitenfellner.
Mit: Jörn Hentschel, Thomas Henniger von Wallersbrunn,Stefanie Lanius, Julia Malkowski, Friedhelm Ptok.
Dauer: 2 Stunden 10 Minuten, eine Pause
www.schlosstheater-celle.de
Dieser Text wurde ermöglicht durch die
"Die Zeitebenen wechseln so geschmeidig wie die Szenerien, die im heute verteufelt niedlich anmutenden Ambiente der Fünfziger Jahre angesiedelt sind. Das Zeitkolorit ist hier mit liebevoller Detailfreude wiedergegeben: vom alten Fotoapparat und der noch nicht coolen Kleidung bis zum klobigen Dampfradio", so Karl-Ludwig Baader in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (5.5.2014). Mit dieser unangestrengten Verspieltheit vermittelt Bernd Rauschenbach eine Botschaft, mit der er das Publikum zum (Nach-)Lesen ermuntern will.
So sehr sich die Figuren bemühen, ungetrübte Tage zu verleben – die Erinnerung an die jüngere Vergangenheit, an die Kriegszeit, ist zu frisch, um das zuzulassen, schreibt Jörg Worat in der Celleschen Zeitung (5.5.2014). Die Inszenierung splitte sich in einen Spiel- und einen Erzählstrang auf, die Grenze zwischen beidem bleibe stets fließend. Und dass man bei der Sprache dieses Autors mit allerlei Eigenwilligkeiten rechnen muss, ist klar. Das fünfköpfige Ensemble ist typenmäßig ausgezeichnet besetzt. Fazit der Kritik: "Kein leichter Abend, und er gefällt auch offenbar nicht jedem im Premierenpublikum. Doch die Zustimmung überwiegt, zu Recht: Man sollte sich dieses etwas andere Bühnenereignis nicht entgehen lassen."
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.
mehr nachtkritiken
meldungen >
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral


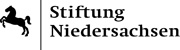




















neueste kommentare >