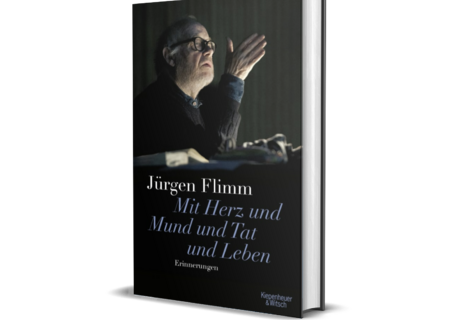Tragödie und dramatisches Theater - Hans-Thies Lehmanns gewichtige Studie über die längst nicht tote Tragödie
Fremd zu sein bedarf es wenig
von Dirk Pilz
2. September 2014. Zunächst das: Was für ein Luxus, in Zeiten wie diesen ein Buch über Wohl und Wehe der Tragödienkunst zu lesen. Wie beruhigend, versichert zu bekommen, Tragödien gebe es einzig im Theater, nicht da draußen in der Wirklichkeit, auch nicht in uns drin als Wesenszug unserer Seelen oder Sehnsüchte. Bleibt nur zu hoffen, dass sich daran nichts ändert.
Auf dem Tisch liegen gut siebenhundert Seiten Theorie, ziegelsteinschwer, hart gebunden. Der erste Eindruck: Hier hat jemand enormen Erklärungsbedarf. Was sind Tragödien? Was ist das Tragische?
In mehreren Anläufen und ausgiebigen Ausflügen in die Geschichte, mit vielen kräftigen Seitenhieben auf die konkurrierenden Kollegen aus den philosophischen und literaturwissenschaftlichen Stuben und herben Standpauken für die Damen und Herren der theaterwissenschaftlichen Fakultäten versucht der Frankfurter Theaterertheoretiker Hans-Thies Lehmann Antworten zu finden. Das ergibt kein Buch aus einem systematischem Guss, es wirkt eher, als müsse es sich auf spitzen Zehen und mit zuweilen sonderbar stelzender Sprache hochgefährlicher Gegend nähern.
Dabei hat Lehmann seine Antwort auf die Frage nach dem Sein der Tragödie schnell bei der Hand. Es gelte, steht gleich auf der ersten Seite, der Tragödie ihre "theatrale Dimension" zurückzugeben. Es gelte folglich, wider die irreführende Reduktion der Tragödie auf Literatur zu streiten. Die Tragödie, sagt er, ist "unabdingbar an Theater gebunden", nicht aber an dramatisches Theater. Denn Tragödie ist eine Sache der Erfahrung, einer tragischen Erfahrung, die wiederum ohne "performative Wirklichkeit" nicht zu haben ist.
Eine heimliche Leerstelle
Das ist wünschenswert klar und eindeutig. Lehmann macht trotzdem viele Worte. Nicht nur, weil er viel zu berichten weiß, über Brecht und Heiner Müller, Jan Fabre, Einar Schleef, Hölderlin oder die Antike. Alles andere wäre bei diesem ausgewiesenen Fachmann auch eine Enttäuschung, und es sei Wissensmännern wie ihm unbenommen, dass sie den Leser an ihren Schätzen teilhaben lassen wollen. Man lernt auch gehörig dabei. Vielen Dank.
 Dennoch rührt der enorme Mitteilungsdruck aus anderer Quelle. Es ist zwar nicht Lehmanns Verantwortung, dass seine einstweilen theaterbetriebsweltberühmte Studie zum "Postdramatischen Theater", erstmals 1999 erschienen, zur Heiligen Schrift der neueren und neuesten Theatergrabenkämpfe wurde, dass sie noch immer als Kampfschrift gegen ein vermeintlich überholtes Literaturtheater und für die schöne neue Welt des Performativen herhalten muss; das Buch war gottlob kein Manifest, sondern eine Analyse des jüngeren Bühnengeschehens. Aber es traf einen bestenfalls auf Ironie, in ärgeren Fällen auf Zynismus gebürsteten, allen Hierarchien und festen Ordnungen abholden Theaternerv, wenn nicht den neoliberal gestimmten Zeitgeist, eignete sich also hervorragend zum apologetischen Schutzschild.
Dennoch rührt der enorme Mitteilungsdruck aus anderer Quelle. Es ist zwar nicht Lehmanns Verantwortung, dass seine einstweilen theaterbetriebsweltberühmte Studie zum "Postdramatischen Theater", erstmals 1999 erschienen, zur Heiligen Schrift der neueren und neuesten Theatergrabenkämpfe wurde, dass sie noch immer als Kampfschrift gegen ein vermeintlich überholtes Literaturtheater und für die schöne neue Welt des Performativen herhalten muss; das Buch war gottlob kein Manifest, sondern eine Analyse des jüngeren Bühnengeschehens. Aber es traf einen bestenfalls auf Ironie, in ärgeren Fällen auf Zynismus gebürsteten, allen Hierarchien und festen Ordnungen abholden Theaternerv, wenn nicht den neoliberal gestimmten Zeitgeist, eignete sich also hervorragend zum apologetischen Schutzschild.
Die heimliche Leerstelle in Lehmanns damaligem Buch und in der Rezeption blieb allerdings jene Frage nach der Tragödienkunst, die der Postdramatik durch die Finger zu gleiten scheint, zumindest in der Theorie. Sie will Lehmann jetzt füllen und zugleich zeigen, dass Postdramatik und Tragödie sich durchaus vertragen. Dass allen "Unkenrufen der Theorie" zum Trotz die Tragödie keineswegs ausgestorben ist.
Andere Zeiten, andere Tragödien
Ja, sie lebt. Ja, es gibt keine Gründe, zu hoffen oder zu fürchten, dass sie verschwunden sei, solange man die Tragödie nicht einzig im Drama, im Text oder einer bestimmten Wesensart des Menschen, sondern in einer spezifischen Weise der Erfahrung sucht. Lehmann behauptet folglich, die tragische Erfahrung habe "in verschiedenen Zeiten unterschiedliche Ausdrucksformen" angenommen.
Das klingt zwar doch wieder nach der Uralt-Behauptung eines 'Tragischen', das als geschichtslose Idee durch die Zeiten schwebe und auf die Erde der Theatertatsachen nur jeweils anders heruntergeholt werden müsse. Aber Lehmann meint wahrscheinlich die unbestreitbare Tatsache, dass die Tragödie lange als Textgenre überliefert wurde, im Gegenwartstheater jedoch erscheint wie sie auch früher schon hätte betrachtet werden müssen, eben als theatrale Dimension.
Man findet kaum Gründe, daran zu zweifeln, vor allem das ist diesem gewichtigen Buch zu danken, das man in einem Rutsch nicht wird lesen können. Man hat es wiederholt zu studieren, mit Gewinn vermutlich. Aber es bleiben jetzt schon, nach einer ersten Lektüre, Fragen, ein paar von ihnen seien zumindest benannt.
Lehmann sagt da zum Beispiel, das Theater erfülle die Definition des Unheimlichen, die Freud gegeben habe. "Es setzt nicht irgendeine, sondern die eigentlich fundierende begriffliche Distinktion aufs Spiel." Unbeachtet des Umstands, dass Theaterwissenschaftler aus der Nische ihres Faches heraus immer die Neigung haben, ihre Profession und ihren Gegenstand zum Welthöhepunkt zu verklären, ausgenommen auch die Tatsache, dass man sich mit Freuds Begriff des Unheimlichen eine Menge Folgeprobleme einhandelt, die Aspekte von Heilung und Therapie etwa (was wäre das in Bezug aufs Theater? Womöglich, es einmal mehr mit unguten Erwartungen zu überfrachten?) – ließe sich eben dies nicht vielmehr von der Religion und der Gotteserfahrung sagen? Spricht so nicht die Theologie von ihrem Zuständigkeitsbereich, besonders jene protestantisch-deutsche Tradition, die in religiösen Erfahrungsdingen auf Gefühl und Gestimmtheit abzielt, was sich auf unheimliche Weise mit Lehmanns Rede von einer "Erfahrung des tragischen Vorgangs" trifft, die einem "Aussetzer des Vernunftprogramms" gleiche? Was ist, von Lehmanns Perspektive aus gesehen, der Unterschied zwischen Hiob und Hamlet?
Gemütliche Gewissheiten
Ein Zweites: Das Theater, behauptet Lehmann im trauten Einklang mit seinen früheren Schriften und dem Gros der gegenwärtig tonangebenden Bühnenwissenschaft, mache sich zur Aufgabe, begriffliche Ordnungen, Verordnungen, Anordnungen zu stören. Abgesehen davon, dass dies ein Gemeinplatz ist, den seit Platon nie jemand ernsthaft bestritten (nur mit immer anderen Konsequenzen belegt) hat – geht dieses Dogma nicht von fixen, allgemeinen, irgend verortbaren Ordnungen aus, die da zu stören wären? Welche sollten das sein? Gibt es sie überhaupt? Wo denn, im Bürgertum, beim Abo-Publikum, bei den Performance-Freunden? Sind sie nicht vielmehr eine Schimäre, eine Pappwand, die man aufstellt, um sie effektvoll einrennen zu können?
Denken, so Lehmann, auch das Denken auf der Bühne, diene der "Zerrüttung von Gewissheiten". Heißt das nicht längst, dass es die inzwischen gemütliche Gewissheit zu zertrümmern gelte, es gebe da noch ein "Denken des Anderen", also Gewissheiten 'bei den Leuten', die zertrümmert werden müsste? Welche? Warum überhaupt?
Noch ein Drittes: Das Tragische, so Lehmann, ist ein "Modus der künstlerischen Welterschließung", keine "Wesensbestimmung des Menschen", keine "Art des In-der-Welt-Seins", also keine Wirklichkeit, die von der Kunst aufgegriffen wird. Sondern eben eine "Dimension der Darstellung" und damit der Erfahrung.
Ja, aber wenn er in guter alter, an der Phänomenologie geschulter Theorietradition in der Erfahrung das Moment der Widerfahrnis betont, wenn er sagt, in ihr habe immer ein "drittes Element Platz: Reflexion, Überraschung, momentane Einsicht, Distanznahme", wenn er weiter vom "Einbruch des Realen" spricht, von der notwendigen "Zäsur", die aus einer ästhetischen eine tragische Erfahrung mache und er, darüber hinaus, diese tragische Erfahrung in einem "Modus der Selbst-Konfrontation", einer "Selbst-Fremdheit" zu finden glaubt, ihr also den "Charakter des Zustoßens von etwas Fremden" zuschreibt – dann wüsste man doch gern, was dieses Fremde sein soll. Woher es rührt, worauf es zielt. Ist es das "schockartige Verstehen des Nicht-Verstehens"? Was soll das bedeuten, außer der Trivialität, dass man im Theater gelegentlich auf etwas gestoßen wird, das man an sich selbst, der Welt, den Anderen, dem Miteinander noch nicht entdeckt hat? Ist das Unbekannte das Fremde? Oder ist umgekehrt Fremdes schlicht das Unbekannte?
Eine Frage der Parteinahme
Daran hängt ein Viertes: Wie kommt es eigentlich, dass Lehmann auch dann die Götter ausspart, als müsse man sich ihrer schämen, wenn er von der antiken Tragödie spricht? Weil er das Tragische unter allen Umständen als horizontale Erfahrung begreifen will, der alles Vertikale ausgetrieben gehört? Gibt es heutigentags keine Götter und keine Götzendienste mehr? Wirklich? Leben wir tatsächlich oder nur theoretisch unter einem leergeräumten Himmel? Woher überhaupt diese Furcht vor der Metaphysik?
Das ist, am Rande, einer der entscheidenden Unterschiede zu Wolfram Ettes großer Studie Kritik der Tragödie: Sie bezieht die metaphysische Dimension, jene nicht nur in der Antike spezifisch tragische Vertikalspannung mit ein, die aus der Geschichte des Tragischen wahrscheinlich doch nicht sinnvoll gelöscht werden kann. Man erführe gern, was Lehmann hierzu genauer zu sagen weiß, und warum sich sein Buch darüber ausschweigt. Vielleicht kommt es auch deshalb nicht zur Sprache, weil den von Lehmann ins Zentrum gerückten Punkt vor ihm Ette längst überzeugend herausgearbeitet hat: dass Tragödien "Prozesse kollektiver Selbstzerstörung" sind und mit Grenzüberschreitungen zu tun haben, dass sie, wie Lehmann im Einklang mit Ette schreibt, Vorstellungsmodelle "jenseits der Träume der Aufklärung, jenseits der romantischen Verinnerlichung" sind.
Allerdings lässt Ette die Theaterpraxis außen vor, er schaut vornehmlich auf Texte. Und Lehmann sagt, sehr zu recht, dass Tragödien nicht in Texten, sondern im Unverfügbaren des Theaters zu Hause sind. Womöglich gehört es zur Dynamik der Wissenschaftsgeschichte, dass auf Vereinseitigung mit Gegenvereinseitigung reagiert wird – wider die Dominanz des Textes in der Tragödientradition setzt Lehmann die Vorrangstellung der Darstellung.
Er ist hier auch sehr ehrlich, wenn er von der "Parteinahme" spricht, wenn er "bekennt", dass ihm bei der Arbeit an seinem Buch immer wieder der Gedanke kam, "ob nicht doch die Tragödie in ihrer eigentümlichen Verbindung von affektiver und mentaler Erschütterung am Ende das Theater schlechthin sei". Das Theater schlechthin, die Tragödie schlechthin, das Tragische schlechthin: dergleichen verbietet sich für Lehmanns Grundüberzeugung, dass es das Theater schlechthin nicht gibt, nicht geben kann und muss, im Grunde.
Vermutlich wird eine Tragödientheorie, falls je überhaupt, erst dann ihrem Gegenstand gerecht, wenn sie nicht mehr mit Stellvertreterdebatten und innertheaterbetrieblichen Scharmützeln belastet wird, wenn sie vom Kampf wider eine textzentrierte Tradition und für eine darstellungsorientierte Sichtweise befreit ist. Wenn Raum ist für den Gedanken, dass zwischen Himmel und Hölle, zwischen Theater und Theorie mehr ist, als sich die Tragödienwissenschaft vorzustellen vermag: die unerhörte Freiheit eines ästhetischen Spiels, das seine Regeln und seine Regelverstöße immer erst mit dem Spiel selbst erfindet.
Hans-Thies Lehmann:
Tragödie und dramatisches Theater.
Alexander Verlag, Berlin 2013, 734 S., 68 Euro
Mit der Berliner Zeitung hat Hans-Thies Lehmann am 21. August 2014 über sein Buch gesprochen – und über die Zukunft des Stadttheaters. Hier geht es zur Presseschau.
Weitere Besprechungen zu Büchern über Tragödie und ihre Theorie: Bernhard Greiners Literaturgeschichte des aufrechten Ganges, eine Ausgabe der Zeitschrift Maske & Kothurn über Formationen des Chorischen im gegenwärtigen Theater, Wolfram Ettes Kritik der Tragödie und Johanna Canaris über den Mythos Tragödie.