meldungen >
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral


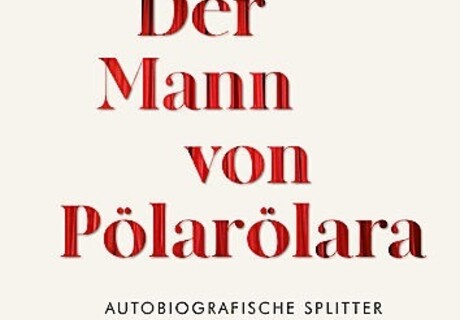
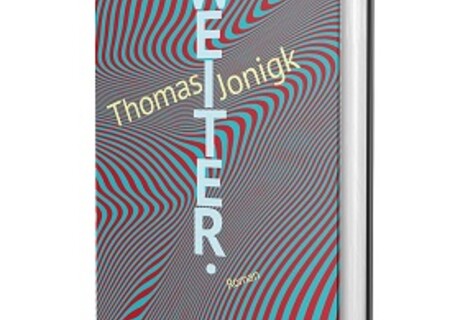
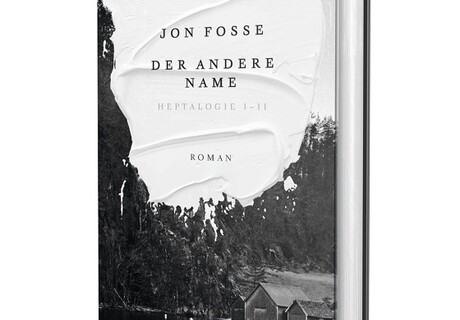
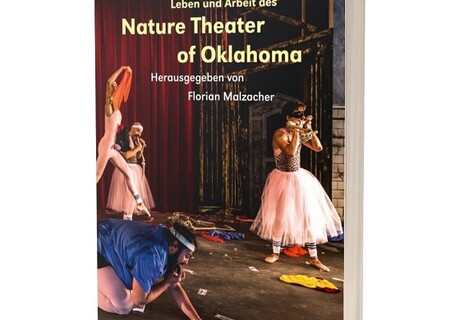
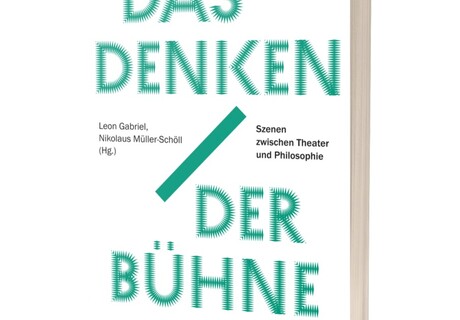
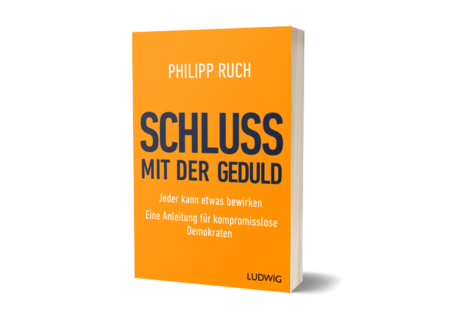

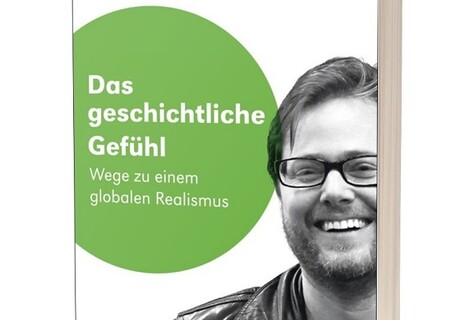
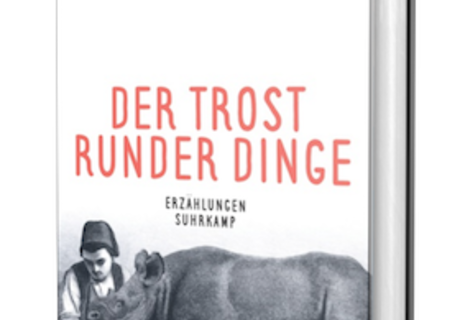
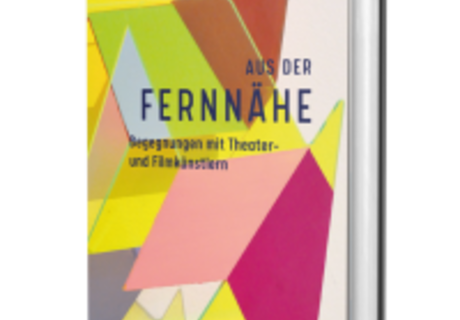
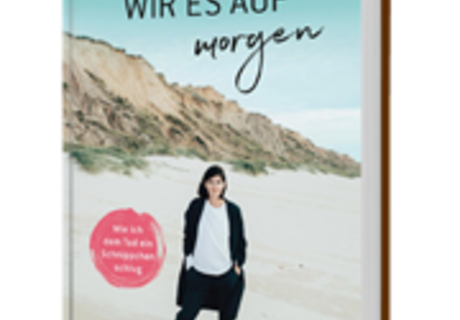
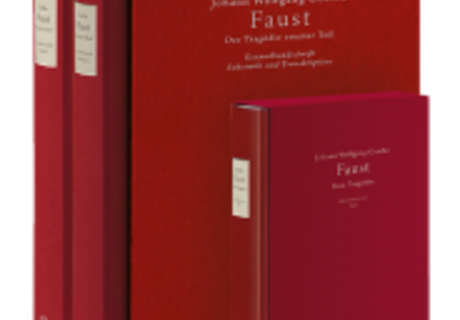
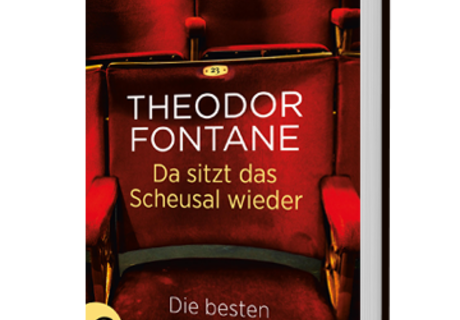
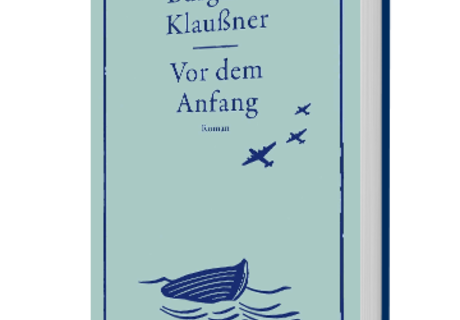
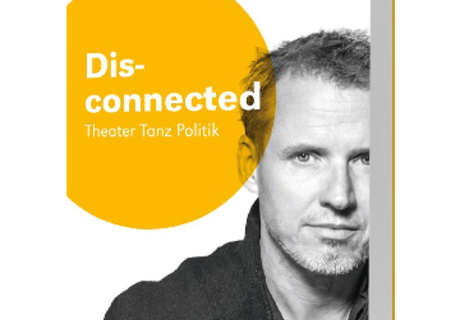
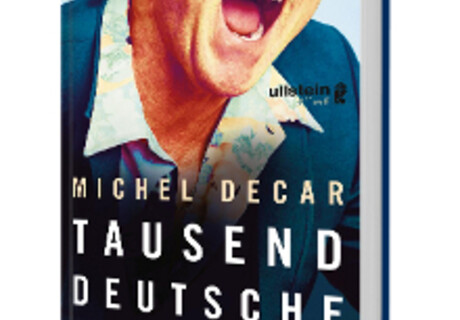
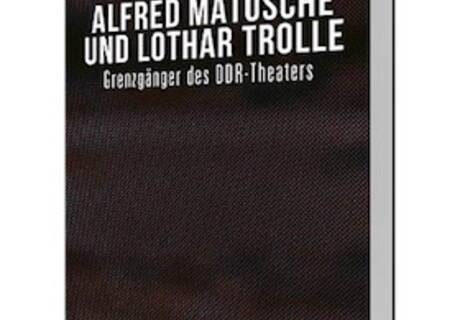
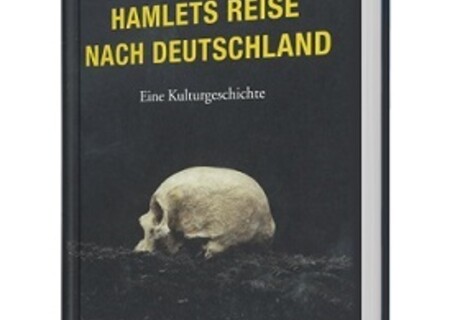






neueste kommentare >