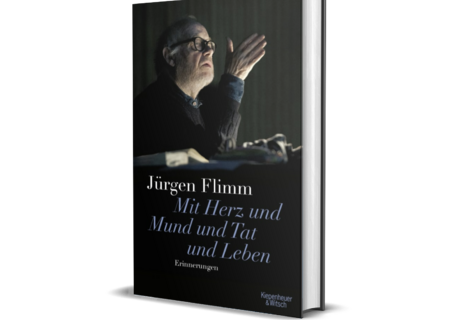Michael Horeni - Die Brüder Boateng. Drei deutsche Karrieren
Es gibt kein großes weißes Wir
von Nikolaus Merck
9. Mai 2012. Eigentlich wussten wir es, seit die deutsche "Internationalmannschaft" bei der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika 2010 so begeisternd aufspielte: Das große weiße Wir in Deutschland gehört der Vergangenheit an. Migrantenkinder prägen das Bild der neuen Nation.
Was die alte Nation nicht davon abhielt, sich, kaum war die erste Liebe zu den Ballzauberern verflogen, sogleich in eine Debatte zu stürzen, warum die Özil, Khedira und Boateng nicht lippen- und herzenbewegt vor ihren Auswahlspielen die deutsche Nationalhymne mitsängen. Identifizieren sich die "Ausländer" etwa nicht mit Deutschland, fragte der Boulevard. Und passte in dieses Zweifelbild nicht auch das Foul, mit dem Kevin-Prince Boateng (der "englische" Bruder des Nationalmannschafts-Boateng) beim englischen Cup-Finale Michael Ballack so schwer verletzte, dass der Kapitän des deutschen Nationalteams das Turnier in Südafrika absagen musste? Kurz zuvor hatte Boateng verkündet, weil der DFB ihm keine Chance gebe, laufe er eben für Ghana auf, einen WM-Gegner der deutschen Mannschaft. Wollte das enfant terrible aus Berlin den "Capitano" etwa vorsätzlich verletzen?
Die schwierigen Verhältnisse
In "Die Brüder Boateng. Drei deutsche Karrieren" untersucht Michael Horeni, Fußball-Experte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Vorgeschichte und Hintergründe dieser Debatten. Sie bilden die Folie für den umwegsamen Aufstieg des Mittelfeldstars des AC Milan, Kevin-Prince Boateng, den Horeni mit dem Werdegang seines älteren Bruders George und dem des Halbbruders Jérôme kontrastiert.
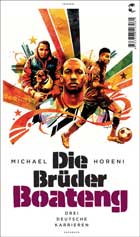 Drei Söhne aus zwei Ehen hat Prince Boateng, der Anfang der achtziger Jahre mit einem Universitäts-Stipendium aus Ghana nach Berlin kommt, auf dem Bau landet und später als DJ reüssiert. Zwei von ihnen wachsen im Wedding auf, ein sogenannter sozialer Brennpunkt mit überdurchschnittlichem Ausländer- und Immigrantenanteil, einer im bürgerlichen Wilmersdorf. Fußball-Großtalente sind alle drei.
Drei Söhne aus zwei Ehen hat Prince Boateng, der Anfang der achtziger Jahre mit einem Universitäts-Stipendium aus Ghana nach Berlin kommt, auf dem Bau landet und später als DJ reüssiert. Zwei von ihnen wachsen im Wedding auf, ein sogenannter sozialer Brennpunkt mit überdurchschnittlichem Ausländer- und Immigrantenanteil, einer im bürgerlichen Wilmersdorf. Fußball-Großtalente sind alle drei.
Als der 1982 geborene George in den frühen neunziger Jahren bei Hertha BSC Berlin spielt, trainieren die Jugendmannschaften noch auf einer Wiese zwischen Hundehaufen. Es war die Zeit, schreibt Horeni, in der die "Selbstzufriedenheit im DFB und der Bundesliga grenzenlos" war. Kein Gedanke an gezielte Nachwuchsförderung, schon gar nicht bei schwierigen Jungs wie George Boateng, der mit "unglaublich viel Talent, aber schwachem Willen zur Anpassung, versuchte Profi zu werden". Auch bei Hertha nimmt sich niemand des Jugendlichen aus "schwierigen Verhältnissen" an, von Unterstützung in der Schule ganz zu schweigen. Obwohl der Trainer ihn für das größte Talent seit Jahren hält, kommt er mit George nicht klar. Er wird im Verein aussortiert, bricht die Schule ab, hängt rum, landet im Knast.
Die Abwesenheit des Vaters
Der fünf Jahre jüngere Kevin, mütterlicherseits ein Großneffe des Helden von Bern Helmut Rahn, profitiert davon, dass George nach seinem Knastaufenthalt beschließt, auf seine kleineren Brüder aufzupassen. Der Straßenfußballer Kevin Boateng, schreibt Michael Horeni, war damals das vielleicht größte Talent des deutschen Fußballs. Er durchläuft alle Jugendnationalmannschaften, erhält zweimal die Fritz-Walter-Medaille für besondere Leistungen und wird mit 18 Jahren Profi bei Hertha BSC.
Doch auch für Kevin ist die Abwesenheit des Vaters eine schwere Belastung. Das harte Pflaster im Wedding, der Rassismus, demnach schwarze Deutsche ganz unten in der Werte-Hierarchie rangieren, bilden schlechte Voraussetzungen, um sich erfolgreich anzupassen. In der Pubertät verliert Kevin auf einen Schlag alle männlichen Bezugspersonen, der aufgeweckte und ordentliche Schüler wird "verhaltensauffällig". Als der Jung-Profi Geld in die Hände bekommt, verwechselt er sich alsbald mit dem Bild des Gangsta Rappers, das der Boulevard von dem tätowierten Muskelprotz zeichnet. Falsche Berater, Verletzungspech, Ausschluss aus der Juniorennationalmannschaft folgen. Der Hochbegabte steht vor dem vorzeitigen Ende seiner Karriere.
Der empfindliche Stolz
Jérôme, der 1988 geborene jüngste Bruder, aus der zweiten Ehe des Vaters hat es leichter. Nach dem Niedergang des deutschen Fußballs um die Jahrtausendwende verordnet der DFB den Vereinen den Neuaufbau der Jugendarbeit. Jetzt gibt es Unterstützung und Betreuung. Auch den Rassismus in den Stadien gibt es immer noch, aber der DFB ächtet ihn mit Strafen. Wie George für Kevin zum Vorbild wurde, wird jetzt Kevin zum Vorbild für Jérôme. Aber: Jérôme wächst bei seiner Mutter, einer Stewardess, in halbwegs intakten Verhältnissen auf.
Wedding und Wilmersdorf sind nicht nur unterschiedliche Wohnorte, sondern Chiffren für verschiedene Lebenshaltungen. Selbstverständlich schickt die Mutter Jérôme zur Psychotherapie, als er nach der Trennung der Eltern krank wird. Häufig begleiten sie oder der Vater den Sohn zu Auswärtsspielen und trösten und beruhigen ihn, wenn die Gegner ihn mit rassistischen Sprüchen provozieren.
Der empfindliche Stolz vieler schwarzer deutscher Fußballer, schreibt Horeni, kommt wohl aus dieser Erfahrung der Demütigung. Vielleicht gibt es ja neben den lukrativen Verträgen doch noch andere Gründe dafür, dass Mesut Özil, Sami Khedira und Jérôme Boateng nach der Weltmeisterschaft in Südafrika schleunigst ins Ausland abwandern, während Lahm, Schweinsteiger und Müller in Deutschland bleiben.
Die Debatte um Blackfacing
Thilo Sarrazin glaubt, der Immigrant oder seine Kinder seien böse, dumm oder wenigstens faul. Michael Horenis Buch erzählt eine andere Geschichte. Es handelt von immensem Fleiß und harter Aufstiegsarbeit und es schildert, wie schwer es die deutsche Gesellschaft den Nachkommen der Einwanderer macht, ein Leben in Respekt und Anerkennung zu führen. Es erzählt auch von Regeln, fehlenden Grenzen und der unersetzlichen Rolle der Väter.
Die Weigerung vieler Kommentatoren, zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die bundesdeutsche Gesellschaft grundlegend verändert hat, war eines der Probleme, das der Blackfacing-Debatte auf nachtkritik.de zugrunde lag (hier und hier und hier und hier).
Die Städte sind bunt, der so genannte Ausländeranteil in den Großstädten des Westen und Südens beläuft sich auf ein Viertel der Einwohner, in den Schulen beträgt der Anteil der Kinder mit "Migrationshintergrund" bis zu 60 Prozent. Das große weiße Wir in Deutschland gibt es nicht mehr. Die Sarrazins wie die Kulturkämpfer wider den Islam reagieren darauf mit einer Mischung aus Furcht und Rassismus. Es wird ihnen nicht helfen. Die Geburtenraten sinken, der Facharbeitermangel führt bereits jetzt dazu, dass die Industrie energisch mehr Einwanderung fordert.
Diesen Veränderungen wird sich auch das deutschsprachige Sprechtheater stellen müssen. Es wird lernen müssen, die ihm lange Zeit fremden Erfahrungen der Migranten und Postmigranten auf der Bühne zu repräsentieren. Denn: Wenn das große weiße Wir nicht mehr existiert, genügt es auch nicht mehr, sich schwarz anzumalen, um das "ganz Andere" der Erfahrung, um "den Fremden" ins Bild zu bringen.
Schwarz zählt heute genauso zum Wir wie Weiß. Dass das Theater die Zeichen der Zeit erkannt hat, legen der Erfolg des "postmigrantischen" Ballhaus Naunynstraße und die Debatte über die Zukunft des Stadttheaters nahe. Auch das nachdenkliche Einlenken des Deutschen Theaters bei der Debatte um das Blackfacing in Michael Thalheimers Inszenierung von Dea Lohers Unschuld ist in diesem Zusammenhang ein Zeichen, das optimistisch stimmt.
Michael Horeni
Die Brüder Boateng. Drei deutsche Karrieren
Tropen bei Klett-Cotta, Stuttgart 2012,
268 Seiten, 18,95 Euro.