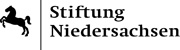Die Jungfrau von Orleans - In Göttingen inszeniert Martin Laberenz eine fremdgesteuerte Johanna
Johanna, das heilige Spielkind
von Jan Fischer
Göttingen, 22. März 2014. Spielkinder, allesamt. Die Witzfigur von Karl VII., der versucht, die letzten Schmuckstücke seiner Geliebten Agnes ans Publikum zu verpfänden, um seinen aussichtslosen Krieg gegen die Engländer zu finanzieren ("Aber nur geliehen, die Requisite macht mir sonst die Hölle heiß"). Johannas Vater, der versucht, sie mit jemandem aus dem Publikum zu verheiraten ("Hier, der da hinten hat zwar nicht mehr so viele Haare, aber der lacht so nett").
Die Brechung zelebriert
Das ist so ungefähr die Gangart, die Regisseur Martin Laberenz mit seiner "Jungfrau von Orleans" in Göttingen einschlägt. Ungefähr, weil einerseits seine Figuren ständig noch "Ja, ne", "Scheiße" und "Mann, so'n Mist" in Schillers geschliffene Sätze einbauen. Andererseits, weil das weniger lustig ist, als es klingt. Wenn Johanna, verzweifelt, verraten von sich selbst und von Gott, an den heruntergelassenen Eisernen Vorhang trommelt, hinter dem die Riesen-Siegessause mit Techno stattfindet, "So 'ne Scheiße" schreit, dann wiederum weinend zusammenbricht, ist das weniger eine Brechung, die nur für den Witz ausgespielt wird, als eine tatsächlich intensive Stelle – Johanna ist verzweifelt genug, dass noch nicht einmal mehr ein vernünftiger Monolog aus ihr herausbrechen kann.
Laberenz findet einen interessanten Kniff für seine Inszenierung: Schon am Anfang gehen die Schauspieler auf die Bühne, als auch das Publikum langsam eintrudelt und sich auf den rot bezogenen Sitzen niederlässt. Sie sitzen auf einfachen Holzstühlen oder laufen sich warm, dehnen sich, besprechen sich noch einmal. Dann deklamieren sie Schiller. Dazwischen findet alles statt: Mal wird mit großer Geste deklamiert, mal mit kleiner Geste von der Göttinger Saunalandschaft erzählt ("Ich gehe da nach der Premiere immer hin"). Mal sind es Figuren, die sprechen, mal sind es Schauspieler. Mal ist es Schillers Sprache, mal ihre. Mal irgendwas dazwischen. Immer wieder wird das Publikum direkt angesprochen, und gerne auch mal angeleuchtet. Laberenz zelebriert in seiner Inszenierung die Brechung, er spielt mit der Vorlage und seinen Schauspielern herum, er bricht alles durch ein Prisma, und bekommt viele unterschiedliche Schattierungen heraus.
Alles ist fremdgesteuert
Selbst die sorgsam zusammengebaut Bühnenbildsymbolik entpuppt sich am Ende als um die Ecke gebrochene Ablenkung – immer wieder taucht der Druidenbaum auf, unter dem Johanna anfangs ihre Schafe hütet: Stöcke ersetzen ihr das Schwert, Stöcke auf dem Bühnenboden sind das Lager der Engländer. Auf der anderen Seite immer auch christliche Symbolik: Ein Kreuz aus Neonröhren hängt von der Bühnendecke herab, immer steht auf der Bühne eine Marienfigur.
 Gerd Zinck, Denia Nironen, Vanessa Czapla, Florian Eppinger, Andreas Jeßing © Nils Bröer
Gerd Zinck, Denia Nironen, Vanessa Czapla, Florian Eppinger, Andreas Jeßing © Nils Bröer
Das alles wird dann aber unwichtig. Denn tatsächlich ist Johannas kompletter Weg ein Irrweg, sind alle Konflikte zwischen Engländern und Franzosen, zwischen König und Königin nur Scheinkonflikte – alle Dogmen sind Dogmen, egal, woher sie kommen, und selbst wer von Gott fremdgesteuert ist, ist fremdgesteuert. Als Johanna das erkennt, kann sie nicht einmal mehr "Scheiße" schreien. Sie kann nur noch auf das Neonkreuz zugehen und dabei zuschauen, wie es ausgeht. Sie kann nur nur feststellen, dass der Regen, in dem sie gerade noch nackt rumgerutscht ist, aus Plastikeimern kam. Sie kann sich nur noch schämen, dass sie nackt ist: Die ganzen Leute – hier zeigt sie aufs Publikum – haben ihr ja dabei zugeschaut. Sie kann nur noch lachen. Böse lachen. Irre lachen.
Spielkinder in der Ecke
Dass das Publikum ständig einbezogen wurde, dass Schillers Text an Alltagssprache zerbricht, das verschnürt Laberenz am Ende zu der großen Pointe, dass er Johanna erkennen lässt, dass sie nur eine Figur in einem viel größeren Spiel war, als sie es je geahnt hätte. Wer würde da nicht wahnsinnig? Seine Johanna ist eine, die sich nicht nur von der Politik abwendet, nicht nur von der Liebe, sie ist eine, die sich von allem abwendet, die sich reinigt: Erst wenn auch der letzte Bühnenmechanismus als Metapher entlarvt ist, erst wenn das letzte Bild benannt ist als das, was es ist – nur ein Symbol –, dann wird der schwere Panzer zum Flügelkleid, und Johanna steigt in den Himmel auf.
Am Ende hat Laberenz ein sauberes und dichtes Paket aus seinen Brechungen, seinem Meta-Theater und Schiller zusammengeschnürt, das von den Schauspielern spielfreudig und tatsächlich lustig rübergebracht, dann aber doch schwer bedeutungsoffen ist – ein Kommentar zum Rückzug aus dem Politischen ins Private? Umgekehrt? Ein Kommentar zur Sinnlosigkeit von Aktivismus? Eine ästhetische Programmatik? Existentielle Fragen nach dem Wesen des Ich und der Fremdbestimmtheit? Krim-Krise? Snowden? Ließe sich alles reininterpretieren, wenn man möchte. Rausinterpretieren lässt es sich nicht eindeutig. Und die Spielkinder stehen nur in der Ecke und lächeln schelmisch.
Die Jungfrau von Orleans
von Friedrich Schiller
Inszenierung: Martin Laberenz, Bühnenbild: Volker Hintermeier, Kostüme: Mascha Mazur, Musik: Friederike Bernhardt, Dramaturgie: Anna Gerhards.
Mit: Vanessa Czapla, Florian Eppinger, Andreas Jeßing, Denia Nironen, Moritz Pliquet, Meinolf Steiner, Gerd Zinck.
Dauer: 3 Stunden, eine Pause
www.dt-goettingen.de
Dieser Text wurde ermöglicht durch die
"Eine Hälfte lang funktioniert das Spiel zwischen Frankreich und England, zwischen Johanna und dem Rest der Welt, zwischen Schiller und Improvisation", schreibt Peter Krüger-Lenz im Göttinger Tageblatt (24.3.2014). "Wunderschöne, urkomische Szenen wechseln sich ab mit viel Drama und Dramatik. Vieles ist wild und ungestüm, manches zart und berührend." In der zweiten Hälfte dann sei schlicht vieles zu gedehnt. "Die einen balgen zu lange, die anderen tummeln sich zu ausgiebig im Paradies." Improvisationen, die noch in der ersten Hälfte locker flössen, holperten jetzt und kämen über Wiederholungen nicht hinaus. "Hier hat ein Regisseur sein Ensemble alleine gelassen. Schade, es hätte ein wirklich bemerkenswerter Abend werden können."
"Der gewünschte große Skandal, der einem Regisseur deutschlandweite Beachtung schenken kann, blieb aus", referiert Johannes Mundry in der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (24.3.2014). Und: "Wer unvoreingenommen an die Sache heranging, musste schon bald den Eindruck gewinnen, dass sich hier ein Regisseur daran abarbeitete, warum er das Stück nicht mag. Dazu bräuchte es freilich kein Publikum." Meist werde gebrüllt statt gesprochen. Albereien überwögen vor ernsthaftem Gespräch. Laute Musik und grelle Scheinwerfer sollten aus der Lethargie ziehen, erzeugten bei den Zuschauern aber "nur gleichmütiges Lächeln". Vanessa Czapla als Johanna leiste an diesem Abend trotzdem Großes. "Sie steht über der Rolle, die ihr zugeteilt ist, weiß Hunderte Register in Wort und Gestik zu ziehen." Auch die anderen sechs Schauspieler erfüllten die Rollen im fragwürdigen Regiekonzept sehr gut. "Mit einem kollektiven Jubelschrei nach dem Verklingen des mäßigen Beifalls am Ende schrien sie ihre Erleichterung heraus."
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.