meldungen >
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin


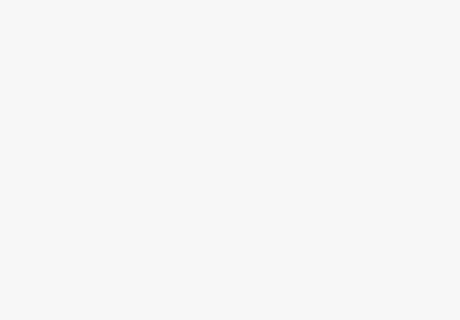






neueste kommentare >