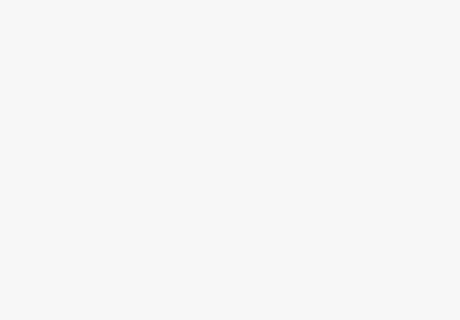Buchhinweise Oktober 2012 - Luc Bondy, Yasmina Reza und der flexible Mensch
Falsche Erwartungen
Luc Bondy, geboren 1948 zu Zürich, ist Regisseur von Beruf, seit Kurzem zudem Intendant am Pariser Odéon Theater. Jetzt hat er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht, er heißt "Toronto", wie die Stadt in Kanada. Er hat auch schon einen Roman geschrieben, Am Fenster. Ein interessantes Buch, das in der nahen Zukunft spielt. Der Beruf des Theaterregisseurs wird darin zu den verschwundenen Erwerbstätigkeiten gerechnet.
 Bondys Gedichte dagegen gehören zur Unterform der Schubladenlyrik, die ihr Verschwinden nicht fürchten muss. Es hat sie immer gegeben, man wird sie auch künftig verfertigen. Denn sie suchen den Bund mit dem Zeitlosen, an das die Menschen auch dann noch glauben, wenn das Wort Gott längst vergessen sein wird, falls es je vergessen wird. So oder so: Die Schubladenlyrik bleibt, wobei sie aber keineswegs mit der sogenannten Schuhkartonlyrik verwechselt werden darf. Zu ihr gehören jene lyrischen Versuche, die äußerst weit verbreitet sind. Handelt es sich dabei doch um diejenigen seelenschmatzenden Gedichte, die in besonders geistschwachen oder besonders gefühlsstarken Momenten entstehen, vornehmlich zu vorgerückter Stunde, und besonders gern mit Angelegenheiten des Herzens befasst sind. Ihre Verfasser entscheiden sich in der Regel klugerweise, sie vor der Öffentlichkeit versteckt zu halten, weil sie äußerst privat, wenn nicht peinlich sind, vermögen es aber aus Erinnerungsgründen meist nicht, sie schlicht wegzuwerfen. Deshalb der Schuhkarton.
Bondys Gedichte dagegen gehören zur Unterform der Schubladenlyrik, die ihr Verschwinden nicht fürchten muss. Es hat sie immer gegeben, man wird sie auch künftig verfertigen. Denn sie suchen den Bund mit dem Zeitlosen, an das die Menschen auch dann noch glauben, wenn das Wort Gott längst vergessen sein wird, falls es je vergessen wird. So oder so: Die Schubladenlyrik bleibt, wobei sie aber keineswegs mit der sogenannten Schuhkartonlyrik verwechselt werden darf. Zu ihr gehören jene lyrischen Versuche, die äußerst weit verbreitet sind. Handelt es sich dabei doch um diejenigen seelenschmatzenden Gedichte, die in besonders geistschwachen oder besonders gefühlsstarken Momenten entstehen, vornehmlich zu vorgerückter Stunde, und besonders gern mit Angelegenheiten des Herzens befasst sind. Ihre Verfasser entscheiden sich in der Regel klugerweise, sie vor der Öffentlichkeit versteckt zu halten, weil sie äußerst privat, wenn nicht peinlich sind, vermögen es aber aus Erinnerungsgründen meist nicht, sie schlicht wegzuwerfen. Deshalb der Schuhkarton.
Ganz anders die Schubladenlyrik. Auch sie entspringt zwar ausgesucht besonderen Augenblicken intensiver Selbst- und manchmal auch Weltwahrnehmung, aber sie sucht doch mehr als den Dialog mit dem eigenen zittrigen Ich. Sie will für alle sprechen, zumindest für alle, die in dieselbe Richtung zu fühlen vermögen. Sie ist also, potentiell wenigstens, veröffentlichungswürdig. Einzig ihr hoher zittriger Ich-Gehalt vermag die Scheuen von einer Publikation zurückhalten. Deshalb die Schublade.
Luc Bondy ist nicht scheu, offenbar, oder mutig. Er hat 49 meist reimlose Verstexte seines vermutlich weit umfangreicheren Gedichtschatzes zu einem Band geformt, der durch seine Furchtlosigkeit besticht. Denn sie durchwandern die Gebiete des Herzens von den peinlichen bis zu den pathetischen Winkeln. Die Liebe und das Leiden an der Liebe, die Einsamkeit der Seele und der drängende Wunsch nach Heimat, die rastlose Hast nach Glück und die Verlorenheit des Ich – darum geht es in diesen seltsam offenherzigen, fast bestürzend distanzlosen Gedichten. Ihre Poesie speist sich aus der Weigerung, die Flüchtigkeit des Daseins in deutungsbedürftigen Metaphern zu fassen. Ihr geheimer Nenner ist die allseits bekannte, aber für Schubladenlyriker noch längst nicht erkannte Erkenntnis: Man nimmt sich mit, wohin man auch reist, sei's nach Toronto oder nach Kasachstan, ganz gleich, wen man auch liebt oder verlässt, was man auch hofft und erduldet. Das zentrale Gedicht trägt folgerichtig den Titel "Ohne Titel". Dies sind die ersten Verse:
Unsere Vergangenheit ist verseucht
von falschen Erwartungen,
die in ihrer Gegenwart lebendiger
Traum waren.
Man fällt in eine seelenschaukelnde Schwermut beim Lesen dieses Bandes, es zieht einem die Selbsttrauer in die Glieder. Es ist alles so traurig, ach. Ja. Und endlich. Sterbensendlich.
Wer des Trostes bedarf, solcher Schubladenlyrik womöglich mit Skepsis begegnet und gern sich an Bondy-Inszenierungen erinnert, die zwar keineswegs schwermutlos, aber tiefer und höher steigen zugleich, das Sanftmütige streifen und Bekanntschaft mit den herbstzeitlosen Gefilden des Gemüts machen, möge sich an dem Gedanken erwärmen, dass der Lyriker Bondy mit dem Regisseur Bondy kaum etwas gemein hat. (Dirk Pilz)
Luc Bondy:
Toronto. Gedichte.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2012, 61 S.,
14,90 Euro
Leben heißt sterben
So wie das Leben vor der Geburt beginnt, gibt es viele Abschiede, bis das Leben mit dem Tod endet. Aber dass es endet, ist von Geburt an klar. Eine Metaphysik, die aufs Jenseits zielt, ist der Gegenwart abhanden gekommen. Alles Leben endet, einiges später, anderes früher. Weiß man das erst einmal, wittert man das Vergehen in den kleinsten Alltagsdetails.
 Yasmina Reza jedenfalls spürt es in den kurzen Texten, die der Band "Nirgendwo" vereint, vor allem in der Familie auf: Der sterbenskranke Vater verpatzt am Klavier zum ersten Mal seine Lieblingssonate, und das Wissen um sein baldiges Ende schwingt mit. Der Sohn lehnt plötzlich das langgeübte morgendliche Abschiedsritual ab und will von nun an ohne mütterliches Winken den Weg zur Schule antreten. Mal schreibt Reza über eine Fahrt nach Budapest, der Geburtstadt ihrer Mutter. Dann erinnert sie sich an Szenen aus der eigenen Kindheit, und immer schwingt ein trauriges Wissen mit über die Vergeblichkeit, in die Kindheit zurückzugelangen oder darüber, dass jeder glückliche Moment Gegenwart gleich schon wieder in Vergangenheit zerrinnt.
Yasmina Reza jedenfalls spürt es in den kurzen Texten, die der Band "Nirgendwo" vereint, vor allem in der Familie auf: Der sterbenskranke Vater verpatzt am Klavier zum ersten Mal seine Lieblingssonate, und das Wissen um sein baldiges Ende schwingt mit. Der Sohn lehnt plötzlich das langgeübte morgendliche Abschiedsritual ab und will von nun an ohne mütterliches Winken den Weg zur Schule antreten. Mal schreibt Reza über eine Fahrt nach Budapest, der Geburtstadt ihrer Mutter. Dann erinnert sie sich an Szenen aus der eigenen Kindheit, und immer schwingt ein trauriges Wissen mit über die Vergeblichkeit, in die Kindheit zurückzugelangen oder darüber, dass jeder glückliche Moment Gegenwart gleich schon wieder in Vergangenheit zerrinnt.
Wer in Rezas Theaterstücken die Genauigkeit und auch den Witz schätzt, mit dem sie in die Leerstellen des Lebens eindringt, findet hier eine überraschende Melancholie vor. Selbst, wenn's komisch werden soll und sie etwa beschreibt, wie sie mit dem Vater über körperliche Veränderungen lacht, kommt in diesen kurzen, tagebuch-artigen Skizzen keine Heiterkeit auf. Nein, im Nebeneinander von Werden und Vergehen fühlt sich diese Autorin nicht wohl. Aber sie versucht, sich mit offenem Visier dem Vergehen der Zeit zu stellen und ist sich auch für pathoshafte Erkenntnisse nicht zu schade. Wer sein Bild über die immer etwas hermetisch wirkende Autorin erweitern will, dem sei zu dem Buch geraten, das etwas von einem Familienalbum hat: keines mit Bildern, aber mit geschriebenen Aufnahmen. (Simone Kaempf)
Yasmina Reza:
Nirgendwo
Aus dem Französischen von Eugen Hemlé, Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel
Carl Hanser Verlag, München 2012, 150 Seiten,
17,90 Euro
In der Atmosphäre des Vagen
Über die Stückeschreibergeneration der Nach-Dotcom-Ära glaubt man ja, schon alles gehört, gesehen und gelesen zu haben. Angesichts des anhaltenden Hypes um die Heckmanns,Mayenburgs und Düffels dieser Welt geschah die Auseinandersetzung mit deren Werk jedoch bisher häufig entweder enthusiastisch oder polemisch, in jedem Fall aber unsachlich. Wie gut, dass die Trierer Germanistin Christine Bähr mit ihrem jüngst erschienenen Buch "Der flexible Mensch auf der Bühne" eine diesbezüglich erfreulich fundierte wissenschaftliche Abhandlung liefert.
 Im Theorie-Teil liest sich die Studie zwar exakt so sperrig, wie es Dissertationen leider meist so an sich haben, ihre Analysen der einzelnen Theatertexte aber sind auf den Punkt gebracht und ansprechend formuliert. Minutiös arbeitet die Autorin heraus, welche Arbeits- und Familiendarstellungen sich in acht zwischen 2000 und 2005 uraufgeführten deutschsprachigen Theatertexten zeigen und welche Bezüge darin hergestellt werden zu soziologischen Zeitdiagnosen.
Im Theorie-Teil liest sich die Studie zwar exakt so sperrig, wie es Dissertationen leider meist so an sich haben, ihre Analysen der einzelnen Theatertexte aber sind auf den Punkt gebracht und ansprechend formuliert. Minutiös arbeitet die Autorin heraus, welche Arbeits- und Familiendarstellungen sich in acht zwischen 2000 und 2005 uraufgeführten deutschsprachigen Theatertexten zeigen und welche Bezüge darin hergestellt werden zu soziologischen Zeitdiagnosen.
Über Moritz Rinkes "Republik Vineta" schreibt Bähr etwa, es lege den Akzent nicht auf das Anprangern, sondern auf ein "Durchdeklinieren der sich im zeitgenössischen Verständnis von Arbeit offenbarenden Widersprüche und Absurditäten". Genau hier findet sich die Klammer zu allen weiteren analysierten Stücken: Sie spiegeln kommentarlos die Arbeitswelt des "flexiblen Menschen" (Richard Sennett), der sich in der alltäglichen Selbstinszenierung nach dem Motto "Wir alle spielen Theater" (Erving Goffman) als "unternehmerisches Selbst" (Ulrich Bröckling) begreifen muss, und tun dies vorrangig mit dem Mittel der Distanzierung (Komik, Wiederholung, Selektion).
Im Mittelpunkt dieser Texte steht, wie Bähr schlussfolgert, "das Scheitern der Indiviualisierungsprojekte". Dabei herrsche "ein skeptischer Grundton vor, der jede aufscheinende positive Utopie mit einer Atmosphäre des Vagen, Surrealen und Absurden umgibt". Das hat man zwar irgendwie bereits geahnt, doch aus einer so umfassenden Untersuchung wie dieser lässt sich nun auch wissenschaftlich ableiten, was die gegenwärtige deutschsprachige Dramatik in ihrem Innersten ausmacht.
Einerseits wird Kunst heute oft als Fundamentalkritik betrieben, und alternative Gesellschaftsentwürfe im Theater finden entweder gar nicht statt oder werden persifliert. Zugleich kommen die Texte von traditionellen Marxisten wie Brecht auf den Bühnen fast nur noch als wohlfeile Erheiterung von Schulklassen und gealterten 68ern daher, indem ihr utopisches Potenzial durch formal statische Inszenierungen geradezu musealisiert wird. Das mag man gut finden oder nicht. Doch mit der von Christine Bähr prägnant ausgeführten Erforschung der Texte junger deutschsprachiger Dramatiker lässt sich diese Erkenntnis nun nicht mehr als Ausgeburt eines ritualisierten Stoßseufzertums dauernörgelnder Kritiker des postmodernen Habitus' abtun. (Christian Baron)
Christine Bähr:
Der flexible Mensch auf der Bühne.
Sozialdramatik und Zeitdiagnose im Theater der Jahrtausendwende.
transcript Verlag, Bielefeld 2012, 520 S.,
39,80 Euro.
ReichlichRezensionen zu Romanen, Essays, Gedichten, wissenschaftlichen Abhandlungen, Studien und Biographien finden Sie hier.
Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft - Rainald Goetz hat nach langen Jahren endlich wieder einen Roman veröffentlicht, der dem Sound der Wirtschafts- und Finanzwelt folgt
Im Gegenwartsflow
von Wolfgang Behrens
26. September 2012. Seit zweieinhalb Wochen ist das Buch nun auf dem Markt. Demnächst ist Buchmesse, langsam könnte also die erste Rezensionswelle anlaufen. Bei Rainald Goetz aber ist alles anders. Die Rezensionswelle ist längst vorbei, sie brandete hoch und verebbte schnell, und ob noch eine kommen wird, das steht dahin. Als Goetz Anfang August – in einer Aktion, die schon für sich genommen ungewöhnlich genug war – seinen Roman "Johann Holtrop" einer Gruppe eingeladener Kritiker vorstellte (oder sollte man "austeilte" sagen?), da sagte er noch: "Das Buch hat keine Eile, es ist keine Nachricht, kein Event." Doch obwohl oder gerade weil es die übliche Sperrfrist für Rezensionen gab, beeilten sich die großen Zeitungen, diese zu unterlaufen.
Buchhinweise August 2012 - der Chor, die Tragödie und die Schauspieler
Der Eitelstolz des Untertanen
Er sei "wahrscheinlich der größte Liebhaber des Theaters", heißt es ziemlich unbescheiden auf dem Klappentext. Das werden wohl nur wenige unwidersprochen hinnehmen wollen, ist doch die Liebe des FAZ-Kritikers Gerhard Stadelmaier eine recht einseitige: demjenigen Theater, das er selbst Regisseurstheater nennt, begegnet er nämlich nicht als Liebender, sondern als unerbittlich, mancher wird sagen: als verbohrt Hassender.
 Vielleicht aber ist Gerhard Stadelmaier wenn nicht der größte Theaterliebhaber, so doch der größte Bühnenkunstmonarchist. Und das hier anzuzeigende Buch lässt seine Königinnen und Könige auftreten, vor denen er lustvoll auf die Knie geht ("wenn man die entsprechenden Knie hat", wie er verlauten lässt): "die großen Schauspieler und ihre gewaltigen Figuren". Mit dem Eitelstolz des Untertanen preist er sie, und mit einer gewissen Häme verzeichnet es der Monarchist, wenn auch die Republikaner im Staub vor der Größe der einsamen Bühnenherrscher liegen. So erinnert er etwa daran, wie, wenn Bernhard Minetti ein Theater betrat, dieser "den Raum dominierte, wie sich ihm alle zuneigten, wie das ganze demokratische Ensemble der Voyeure, Flaneure und Abonnenten sich ihm geradezu aufatmend zu unterwerfen schien – da ließ sich ein König herab."
Vielleicht aber ist Gerhard Stadelmaier wenn nicht der größte Theaterliebhaber, so doch der größte Bühnenkunstmonarchist. Und das hier anzuzeigende Buch lässt seine Königinnen und Könige auftreten, vor denen er lustvoll auf die Knie geht ("wenn man die entsprechenden Knie hat", wie er verlauten lässt): "die großen Schauspieler und ihre gewaltigen Figuren". Mit dem Eitelstolz des Untertanen preist er sie, und mit einer gewissen Häme verzeichnet es der Monarchist, wenn auch die Republikaner im Staub vor der Größe der einsamen Bühnenherrscher liegen. So erinnert er etwa daran, wie, wenn Bernhard Minetti ein Theater betrat, dieser "den Raum dominierte, wie sich ihm alle zuneigten, wie das ganze demokratische Ensemble der Voyeure, Flaneure und Abonnenten sich ihm geradezu aufatmend zu unterwerfen schien – da ließ sich ein König herab."
Stadelmaier ist ehrlich genug vorwegzuschicken, dass nicht alle großen Schauspieler in seinem Buch vorkommen können. Dass der Bühnenkunstmonarchist, der er ist, jedoch alle Schauspieler ignoriert, deren Bühnenkunst mit dem Arbeiter- und Bauernstaat DDR in Berührung gekommen ist, hat wohl Methode: keine Inge Keller, keine Corinna Harfouch, kein Henry Hübchen, kein Ulrich Mühe.
Dafür gibt es ein buntes Panoptikum des BRD-Theaters, beginnend mit einem klugen Essay über Gustaf Gründgens, weiter über Porträts der großen Schaubühnen-Mimen (Edith Clever, Jutta Lampe, Bruno Ganz …) bis hin zu den großen Spielern unter Dieter Dorn, Peter Zadek, Claus Peymann oder Andrea Breth (Cornelia Froboess, Angela Winkler, Rolf Boysen, Gert Voss, Johanna Wokalek …). Manchmal mag Stadelmaiers Panegyrik gefährdet sein, in allzu leeres Wortgepränge zu gleiten (geradezu inflationär wird das Buch von dem Wort "Welt" in allen möglichen Zusammensetzungen durchzogen), manchmal aber kommt man nicht umhin, sich vor diesem zur Entzückung entzündeten Bühnenherrscheruntertanen zu verneigen. Wenn Stadelmaier seine Vision von Shakespeares "Sturm" entfaltet oder den einen großen Moment von Otto Sander im Film "Das Boot" schildert, dann findet er wahrhaft schöne Worte. Worte, die wohl nur einem großen Liebhaber einfallen. Also doch! (Wolfgang Behrens)
Gerhard Stadelmaier:
Liebeserklärungen. Große Schauspieler, große Figuren.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2012, 240 S., 19,90 Euro.
Ein relativ guter Klang
Als ein unvergleichlich geschmeidiges Instrument hat George Steiner, der Literaturphilosoph, den Chor vor über 40 Jahren in seinem Essay "Der Tod der Tragödie" bezeichnet. Treffenderweise. Denn gleichviel, ob man (wie Steiner) vom Ende der Tragödie ausgeht oder nicht – der Chor hat überlebt: Aus ihm ist einst das Theater erwachsen, aus ihm zieht es noch immer Innovations- und Irritationskraft.
 Kaum verwunderlich also, dass die Zeitschrift "Maske und Kothurn" in ihrer aktuellen Nummer "Formationen des Chorischen im gegenwärtigen Theater" vorstellt. Auch nicht überraschend, dass hier allenfalls ein kleiner Ausschnitt zur Sprache kommt. Einen repräsentativen Querschnitt wollten die Herausgeberinnen ohnehin nicht vorlegen, aber eine lohnende Frage aufwerfen: "Wann ist ein Chor ein Chor?" Die einzelnen Beiträge verlieren sie (leider) immer wieder etwas aus den Augen, aber mit Grund wahrscheinlich. Denn mit dem Bezug auf den Gruppencharakter eines Chores ist nicht allzu viel gesagt, weil jede Gruppe mehr ist als die Summe ihrer Individuen. Weil verschiedene Einzelne verschiedene Gruppen bilden, gerade im Theater.
Kaum verwunderlich also, dass die Zeitschrift "Maske und Kothurn" in ihrer aktuellen Nummer "Formationen des Chorischen im gegenwärtigen Theater" vorstellt. Auch nicht überraschend, dass hier allenfalls ein kleiner Ausschnitt zur Sprache kommt. Einen repräsentativen Querschnitt wollten die Herausgeberinnen ohnehin nicht vorlegen, aber eine lohnende Frage aufwerfen: "Wann ist ein Chor ein Chor?" Die einzelnen Beiträge verlieren sie (leider) immer wieder etwas aus den Augen, aber mit Grund wahrscheinlich. Denn mit dem Bezug auf den Gruppencharakter eines Chores ist nicht allzu viel gesagt, weil jede Gruppe mehr ist als die Summe ihrer Individuen. Weil verschiedene Einzelne verschiedene Gruppen bilden, gerade im Theater.
Was chorische Energie ausmacht, wie sich das Verhältnis von Einzelnem und Masse darstellt, wird in diesem Band daher vornehmlich an konkreten Inszenierungen untersucht, an Claudia Bosses Persern, Volker Löschs Medea und René Polleschs Ein Chor irrt sich gewaltig etwa. Sehr schön, dass auch der leider etwas in Vergessenheit geratene Josef Szeiler hier nicht übergangen wird – in einem Gespräch berichtet er von seiner "Prometheus"-Inszenierung 1983 in Wien und der Arbeit an einem "kreativen Chor". Wann ist ein Chor ein Chor? Szeiler sagt: Im Theater sei ein Chor ein Chor, "wenn jemand dirigiert und alle sprechen gleichzeitig und es schert niemanden etwas." Das erzeuge bestenfalls "einen relativ guten Klang". Er dagegen will mit dem Chor das, was Einar Schleef einst wollte: einen "rituellen Vorgang" schaffen. Auch das gehört zu den Formationen des Chores im Gegenwartstheater: diese Sehnsucht nach dem Rituellen. (Dirk Pilz)
Genia Enzelberger, Monika Meister, Stefanie Schmitt (Hg.):
Auftritt Chor. Formationen des Chorischen im gegenwärtigen Theater.
Maske und Kothurn. Heft 1/2012.
Böhlau Verlag, Wien 2012, 118 S., 16,90 Euro
Das Leiden bleibt
Es gebe da an den antiken Tragödien etwas, das bis heute kontrovers diskutiert werde, woran sich ablesen lasse, dass sie sich keineswegs erledigt hätten, schreibt der Literaturwissenschaftler Bernhard Greiner zu Beginn seiner ehrgeizigen Studie. Das sei die Frage, ob der Mensch in der Tragödie (und im Leben) einem "übermächtigen, ihn verderbenden Schicksal oder einer ihn ins Unglück stürzenden göttlichen Lenkung ausgesetzt und allenfalls fähig sei, Klage zu erheben" oder ob ihm "ein eigener, von ihm auch zu verantwortender Anteil an seinem Geschick zuerkannt werde".
 Das ist die Frage, ja. Anders aber als zuletzt Wolfram Ette in seiner Studie Kritik der Tragödie gibt Greiner darauf keine eigene tragödientheoretische Antwort, sondern führt in das "komplexe Feld der Determinationen, in das die Tragödie das Handeln des Menschen eingelassen zeigt". Die Tragödie, so Greiner, verhandle den Freiheitsspielraum des Menschen, daher auch der Untertitel dieses Buches: "eine Literaturgeschichte des aufrechten Ganges". Es geht in Tragödien damit immer um das Verhältnis von "Gebundenheit und Selbstverfügung".
Das ist die Frage, ja. Anders aber als zuletzt Wolfram Ette in seiner Studie Kritik der Tragödie gibt Greiner darauf keine eigene tragödientheoretische Antwort, sondern führt in das "komplexe Feld der Determinationen, in das die Tragödie das Handeln des Menschen eingelassen zeigt". Die Tragödie, so Greiner, verhandle den Freiheitsspielraum des Menschen, daher auch der Untertitel dieses Buches: "eine Literaturgeschichte des aufrechten Ganges". Es geht in Tragödien damit immer um das Verhältnis von "Gebundenheit und Selbstverfügung".
Das ist kein neuer, aber noch immer ein eleganter Zugriff auf den Stoff. Denn er erlaubt, von Aischylos bis Botho Strauß die Entwicklung der Tragödie zu verfolgen. Ein Überblicksbuch also, allerdings mit punktuellen Tiefenbohrungen, zu Goethes "Faust" oder Wedekinds "Lulu" zum Beispiel. Bemerkenswert, dass es in diesem Buch auch ein eigenes, aufschlussreiches Kapitel zu Benjamin Cohen und den geschichtsphilosophischen Bestimmungen der Tragödie in jüdischer Perspektive gibt. Schade, dass es zum Gegenwartstheater nichts zu sagen weiß.
An der Gegenwärtigkeit der Tragödie und ihrer ästhetischen Verfahren zweifelt Greiner aber nicht: Sie sei gegenwärtig, insofern die Nötigung weiter bestehe, "die Welt vom Leiden aus zu verstehen", wie Nietzsche es in einem seiner nachgelassene Fragmente formulierte. Denn noch immer werden wir mit Furchtbarem konfrontiert, das sich "logisch-vernünftiger Bewältigung" verweigert. (Dirk Pilz)
Bernhard Greiner:
Die Tragödie. Eine Literaturgeschichte des aufrechten Ganges.
Grundlagen und Interpretationen.
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2012, 864 S., 27, 90 Euro
Mehr Bücher? Gibt es hier.
Seite 9 von 12
meldungen >
- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
neueste kommentare >
-
Woyzeck, Leipzig Perfektes Gesamtkunstwerk
-
Pygmalion, Berlin Beseelte Leiber
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Realität
-
RCE, Berlin Mehr als überzeugend
-
RCE, Berlin Geglückt
-
Pygmalion, DT Berlin Augenhöhe
-
Neue Leitung Darmstadt Fest oder frei?
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch
-
Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise