Philipp Ruch: Schluss mit der Geduld - Der Künstler und Aktivist sieht die bundesdeutsche Demokratie dem Untergang geweiht
In der Ideologiefalle
Von Sophie Diesselhorst
4. September 2019. Astrid Lindgren. Während des zweiten Weltkriegs klebte die berühmte schwedische Kinderbuchautorin ausgeschnittene Zeitungsschlagzeilen in ihr Tagebuch und dichtete die Lebenswirklichkeit der von diesen Schlagzeilen Betroffenen hinzu.
So kolportiert es Philipp Ruch, Gründer und künstlerischer Leiter der Aktionskunst-Gruppe Zentrum für politische Schönheit (ZPS), in seinem neuen (zweiten) Buch – und ist völlig begeistert. "Wir alle müssen" (wie Lindgren) "die Säuglinge sterben sehen", so Ruch auf den letzten Zeilen des Buches, dessen hitziger Ton zum Titel passt: "Schluss mit der Geduld".
Jeder kann etwas bewirken
Das meint: Schluss mit einem Europa, das bereits zehntausende Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken ließ und die Schotten immer dichter macht. Schluss mit einem Deutschland, das auf dem rechten Auge blind ist und Wähler*innen eines rechtsextremen AfD-Spitzenkandidaten in Brandenburg besorgt das Fieber misst. Schluss mit Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die dieses Wegschauen vom Mittelmeer und den gesellschaftlichen Rechtsruck normalisieren, indem sie antidemokratische Politiker*innen einladen und in vorauseilendem Gehorsam deren Themen auf die Agenda setzen.
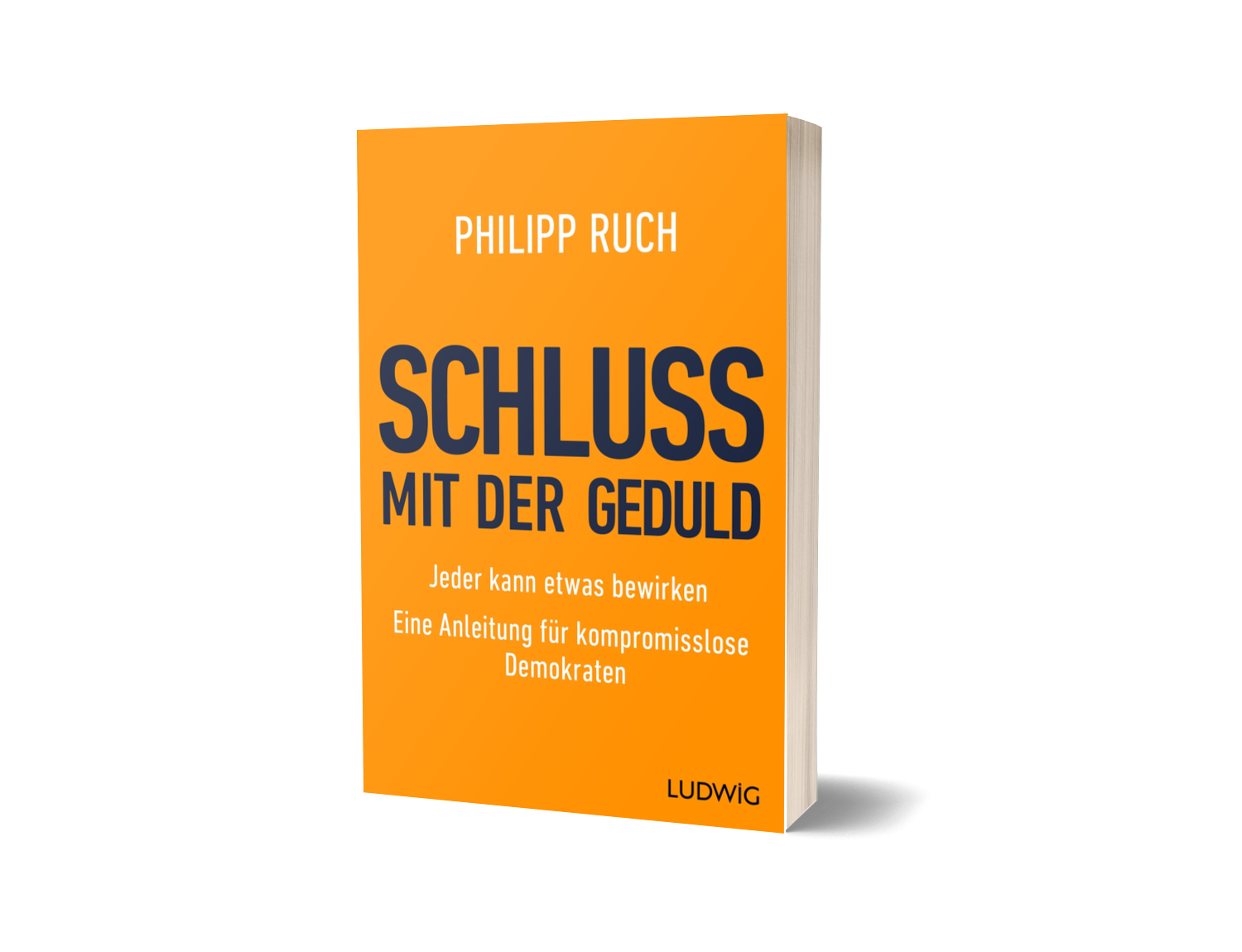 So weit, so konsensfähig bei denen, die Ruch mit seinem Buch erreichen will und wird. "Jeder kann etwas bewirken", heißt es im Untertitel und versprochen wird "eine Anleitung für kompromisslose Demokraten". Aber statt positiver Ansätze, enthält es dann doch nur eine negative, dystopische Revolutionsphantasie.
So weit, so konsensfähig bei denen, die Ruch mit seinem Buch erreichen will und wird. "Jeder kann etwas bewirken", heißt es im Untertitel und versprochen wird "eine Anleitung für kompromisslose Demokraten". Aber statt positiver Ansätze, enthält es dann doch nur eine negative, dystopische Revolutionsphantasie.
Der rechte Bürgerkriegsapparat
Ruch hat die Ausgaben der "Weltbühne" aus dem Jahr 1932 gelesen und mit den Erfahrungen der jüngsten ZPS-Aktion "Soko Chemnitz" (von 2018) kurzgeschlossen. Seine Folgerung: Rechtsextreme Umstürzler, größtenteils bereits in AfD-Amt-und-Würden, bereiten den Staatsstreich vor, indem sie einen "Bürgerkriegsapparat" aufbauen. In Chemnitz hat man letzten Sommer die SA von heute marschieren sehen, so Ruch. Wenn bei den nächsten Bundestagswahlen die AfD stärkste Partei werde, werde die CDU in Person von Jens Spahn sich als Koalitionspartner anbieten und den Fehler machen, der AfD das Verteidigungsministerium und damit die Macht übers (ohnehin rechtsextrem infiltrierte) Militär zu überlassen. Der Rest sei in den Geschichtsbüchern nachzulesen und werde sich wiederholen, wenn nicht ---?
An dieser Stelle kämen dem Buchtitel zufolge die "kompromisslosen Demokraten" ins Spiel. Aber diese sucht Ruch gar nicht erst im gesellschaftlichen Wimmelbild; die Möglichkeit "postmigrantischer Allianzen", wie sie zum Beispiel die Migrationsforscherin Naika Foroutan empfiehlt, wird komplett ausgeblendet; Bewegungen wie "Fridays for Future" werden en passant in die Bedeutungslosigkeit geschubst, indem Ruch "Demonstrationen, Mahnwachen, Lichterketten, Online-Petitionen, Twitter-Hashtags oder Eiskübel-Videos" zu "langweiligen, antiquierten, fantasielosen", "nicht ernst gemeinten" Protestformen erklärt.
Kunstreligiöse Bekenntnisse
Stattdessen beruft er sich auf die eigene aktionskünstlerische Agenda und formuliert im vierten und letzten Kapitel – nach "DENKE!", "KÄMPFE!" und "ÄCHTE!" nunmehr "HUMANISIERE!" betitelt – ein kunstreligiöses Bekenntnis. "Kunst vermag das, wovor Menschen sich von Natur aus fürchten und abwenden, in Mitgefühl zu verwandeln", glaubt Ruch. "Genau das leisten unsere Aktionen: die großen Menschheitskatastrophen psychisch aus der Ecke der verdrängten Unlust, der Schmerzen und des Schreckens in die Mitte der öffentlichen Gefühlswelt zurückzuholen." So schreibt Ruch, ohne seinen moralisch eingefärbten Kunstbegriff im Ganzen näher zu erklären.
Die "öffentliche Gefühlswelt" ist begriffsweltlich gefährlich nah bei den "besorgten Bürgern" angesiedelt, die Ruch ja eigentlich "ÄCHTEN" will. Sowieso bedient er sich im Ton der Dauererregung immer wieder derselben verschwörungstheoretischen Skandalisierungslogik, von der auch die AfD profitiert. "Im Hexenkessel von Chemnitz" herrschte "eine ostdeutsche Welt als Wille und Ausschreitung", für die Silvesternacht von Köln 2015/2016 wird "die russische Diktatur" verantwortlich gemacht, und Donald Trump als "wandelnde Unendlichkeit einer Timeline aus den sozialen Netzwerken" sei für die Medien zum neuen, lukrativen Geschäftsmodell geworden.
Verfassung futsch
Keine Überraschung, dass die Presse als "vierte Gewalt“, deren Wichtigkeit für die Gewaltenteilung erst noch beschworen wurde, später dazu aufgefordert wird, sich von der "fünften Gewalt" der Kunst instrumentalisieren zu lassen und mit dieser zusammen "die Fiktion in der Wirklichkeit schwimmen zu lassen". Ruch geht als Künder in die Ideologiefalle und zieht sich selbst und den Adressat*innen seiner Schrift den Boden der Verfassung unter den Füßen weg. Als Kunst lässt er sowieso nur das gelten, was er selbst macht. Damit höhlt er das "wir" aus, für das er stets zu sprechen behauptet.
 Den Ruß der Geschichte im Gesicht: Philipp Ruch jüngst beim Auftritt auf dem Kunstfest Weimar 2019 im Rahmen der Podiumsdiskussion "Das Riff der Geschichte" © Kunstfest Weimar
Den Ruß der Geschichte im Gesicht: Philipp Ruch jüngst beim Auftritt auf dem Kunstfest Weimar 2019 im Rahmen der Podiumsdiskussion "Das Riff der Geschichte" © Kunstfest Weimar
Vielleicht kann er aber auch einfach nicht mehr aus der Rolle des Aktionskünstlers heraustreten, die er stets mit Rußschlieren im Gesicht markiert: als Symbol für die historische Schuld und die Hässlichkeit der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, gegen die das ZPS mit "aggressivem Humanismus" kämpft. Bei der Buchvorstellung im Berliner Maxim Gorki Theater verzichtete Ruch auf das Ruß, ersetzte es aber durch ein Mehr an Pathos.
Die Kunst-Aktionen des ZPS arbeiten auch mit Pathos, werfen aber in ihren raffinierten Kompositionen genaue Schlaglichter auf reale Machtverhältnisse: "Soko Chemnitz" rückte zuletzt im Winter 2018 zumindest für ein paar Wochen den blinden Fleck des Rechtsextremismus ins Zentrum der Berichterstattung. Alles, was Ruch nun gegen das "Mit Rechten Reden" schreibt, wird angesichts der weiteren Entwicklungen immer triftiger. Aber: Liebe Leser*innen, das haben Sie sich alles schon selbst gedacht. Oder fanden es anderswo sinnfälliger und klarer dargelegt. Also kaufen Sie nicht dieses Buch. Spenden Sie die 12 Euro stattdessen direkt ans Zentrum für politische Schönheit.
Schluss mit der Geduld
von Philipp Ruch
Ludwig Verlag, 192 Seiten, 12 Euro
mehr bücher
meldungen >
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
neueste kommentare >
-
Zusammenstoß, Heidelberg Weg ins Museum
-
Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?
-
Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater
-
Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen


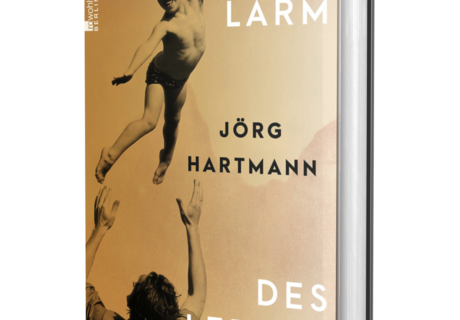
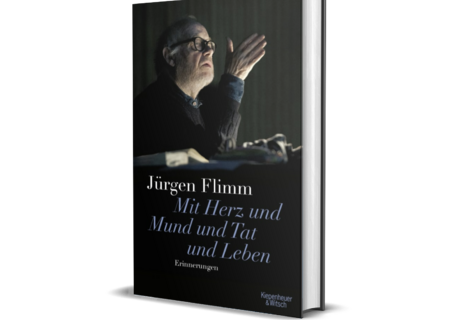
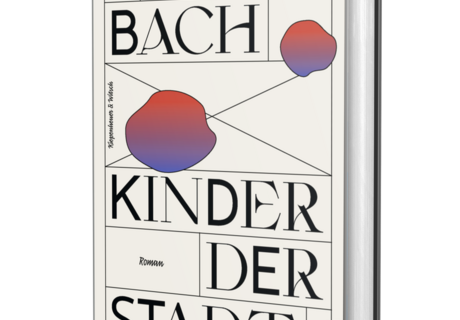
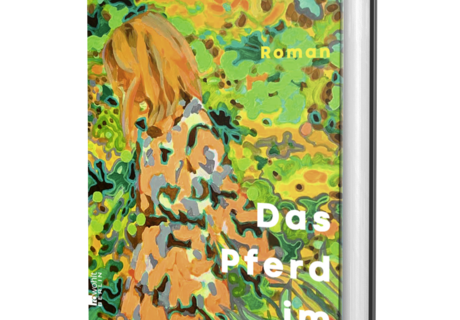
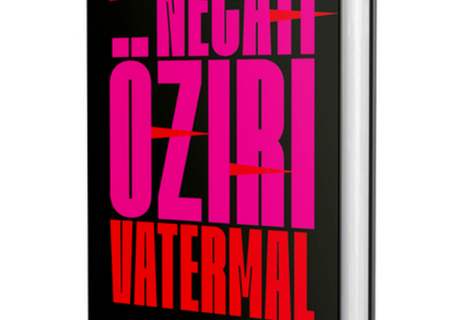






Das Buch ist in meinen Augen (und das sagt ja auch schon der Titel) eine Kampfschrift (mit viel Pathos, zugegebenermaßen). Und dann kommt es mir wohlfeil vor, die Thesen und (Auf-)Forderungen kleinzureden oder zu problematisieren bis nichts mehr übrig ist. Die Botschaft, die ich gehört und gelesen habe ist: Es geht um Wut, es geht um Ungeduld, es geht um Haltung und ums Machen. Die Wut, mit der Ruch schreibt, ist zu spüren, sie trägt mich bei der Lektüre und ich habe mich gerne darauf eingelassen, mich von ihm mitreißen zu lassen: Etwa die Beschreibungen der Echokammer-Polit-Talkshows, die Thesen über Destabilisierungspolitik, die Vorschläge der Rückeroberung des Diskurses durch Intellektuelle, die einsetzende Müdigkeit bei den immer gleichen "langweiligen, antiquierten, fantasielosen", "nicht ernst gemeinten" Protestformen oder die Forderung nach "aggressivem Humanismus". Ich habe das Buch als eine Forderung gelesen, die uns etwas verkürzt sagt: Arsch hoch, Freunde, so kann es nicht weitergehen! Und das ist angesichts der politischen Lage und gerade nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen auch wirklich notwendig. Ruchs Wut ist verständlich und es sollte mehr Leute geben, die sie ebenso teilen wie die Sorge um den Zustand unseres Landes.
Eine Republik braucht kompromissbereite Menschen mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
„Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamen nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt, und wir sollten eine Aufforderung zur Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels“ Karl Popper
„Kerze anzünden: 1 Sternchen; unbefriedigendes Ergebnis, unbekannter Adressat; keine mediale Aufmerksamkeit“
Es ist offiziell Menschenrecht und Bürgerpflicht Widerstand gegen Unrecht zu leisten. Der eine tut es im Kämmerlein, der andere mit dem Megaphon. Es sollte hinreichend bekannt sein, daß an Äusserlichkeiten nicht abgelesen werden kann wer Haltung zeigt wenn es konkret darauf ankommt. Am Beispiel Parkaue: gegen rassistische Äusserungen eines Vorgesetzten oder einer Kollegengruppe einschreiten. Eine verhältnismässig kleine Mühe möchte man meinen, es wäre um ein paar Worte gegangen. Da war keine körperliche Bedrohungslage oder tatsächliche Gewalt (wie es täglich an anderer Orten stattfindet).
Siehe auch die allgegenwärtige, theatrale Abwicklung eines benachbarten Themas, der Gleichstellung: das Aussitzen als Modeerscheinung, oder das äußerliche Aneignen um nicht in Ungnade beim Publikum zu fallen. Morgen wird sich dann an was anderes angepasst; von Haltung und Humanismus gesprochen.
Unter Umständen wäre es wieder an der Zeit Solomon Asch zu bemühen und sich zu fragen, inwieweit man selber eine Politik der ersten Eindrücke praktiziert. Oder Aussagen weniger nach Inhalt oder Faktenlage, sondern nach der sozialen Stellung des Autors beurteilt. Damit meine ich nicht eine Relativierung rechten Gedankenguts, oder eine Minimierung dieser Gefahr. Vielleicht aber die eher unbequeme Frage ob ein Werturteil über die „richtige“ und „falsche“ Art politischen Widerstandes zielführend ist. Und warum die "Ungeduld“ eines Philipp Ruchs einen scheinbar höheren Stellenwert einnimmt als die weitaus weniger Privilegierter.
Zuletzt denke ich an die Dame, die erst in hohem Alter davon erzählte Jahrzehnte zuvor zwei Menschen zur Flucht verholfen zu haben. Etwas, das ihr nur durch ihr unaufälliges Leben möglich war. Kampfschriften waren nie ihr Ding, sie hat regelmässig Kerzen angezündet.