Aufführungsanalyse. Eine Einführung - Christel Weiler und Jens Roselt wenden sich an Theaterwissenschaftler*innen im Grundstudium
Lautes Vorlesen in Gruppensituationen
von Thomas Rothschild
7. September 2017. Die Aufführungsanalyse ist, möchte man meinen, Domäne des Theaterkritikers. Neben der Stückanalyse – zumal bei Uraufführungen oder bei vergessenen und wiederentdeckten Werken – und der Bewertung macht sie den Kern einer Theaterkritik aus. Über die wünschenswerte Gewichtung dieser drei Bestandteile sind Kritiker und Redakteure unterschiedlicher Auffassung, wie der regelmäßige Leser von nachtkritik.de ohne große Mühe beobachten kann.
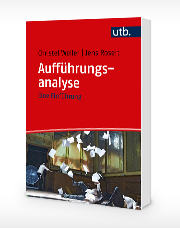 Der vorliegende in einer für Studenten konzipierten Reihe erschienene und von zwei Universitätslehrern geschriebene Band aber wendet sich an Theaterwissenschaftler. Er ist, wie bei vielen Büchern dieses Typs, das Ergebnis von Erfahrungen in Seminaren und spekuliert wohl – der Untertitel "Eine Einführung" deutet darauf hin – auf die Verwendung in Grundkursen, eine Rechnung, die für den Absatz und den Verlag, wenn sie aufgeht, sicher vorteilhafter ist als eine Ausrichtung auf den schwer fassbaren "interessierten Laien".
Der vorliegende in einer für Studenten konzipierten Reihe erschienene und von zwei Universitätslehrern geschriebene Band aber wendet sich an Theaterwissenschaftler. Er ist, wie bei vielen Büchern dieses Typs, das Ergebnis von Erfahrungen in Seminaren und spekuliert wohl – der Untertitel "Eine Einführung" deutet darauf hin – auf die Verwendung in Grundkursen, eine Rechnung, die für den Absatz und den Verlag, wenn sie aufgeht, sicher vorteilhafter ist als eine Ausrichtung auf den schwer fassbaren "interessierten Laien".
Wenig Platz für Regie und Interpretation
Dass die Verfasser offenkundig Erstsemester-Studenten im Visier haben, wird deutlich durch die Voraussetzungslosigkeit ihrer Argumentation und den bisweilen aufdringlichen pädagogischen Tonfall. Es ist, als müssten sie überhaupt erst die Neugier für das Theater wecken, von dem sie gleich im ersten Absatz vermuten, dass es selbst bei Studenten der Theaterwissenschaft "in der Beliebtheitsskala ihrer Freizeitunternehmungen keinen der oberen Ränge" einnehme.
Die Systematik der Einführung ist etwas verwirrend. Während drei Kapitel nach einem knappen Überblick über die Geschichte der Aufführungsanalyse im 20. Jahrhundert unter dem Gesichtspunkt von Disziplinen bzw. Herangehensweisen – Semiotik, Phänomenologie, Erinnerungsarbeit – geordnet sind, beschäftigen sich drei weitere Kapitel mit Elementen der Aufführung: dem Raum, der Figur und dem Text. Regie und Interpretation füllen lediglich einen "Exkurs" von eineinhalb Druckseiten.
Wissenschaftliche Positionen, konkrete Handlungsanweisungen
Nachdem bereits in diesen Kapiteln Beispiele kursorisch analysiert wurden, folgen in einem eigenen Kapitel drei umfangreichere Analysen: der Performance "While We Were Holding It Together" von Ivana Müller, der "Medea" von Michael Thalheimer am Schauspiel Frankfurt und des partizipativen Projekts "Earthport". Erst danach und mit Verweisen auf die analysierten Aufführungen wird auf die Kategorie der Zeit eingegangen. Hinweise auf die Bedeutung von Requisiten – bei einer Aufführungsanalyse nicht ganz unwesentlich – findet man dagegen im Kapitel über den Raum, Ausführungen zum Kostüm im Kapitel über die Figur.
Liegt es daran, dass die zwei Autoren nicht eng genug zusammengearbeitet haben oder dass die einzelnen Kapitel aus Lehrveranstaltungen unterschiedlichen Formats stammen? Die Uneinheitlichkeit der Gesamtstruktur jedenfalls kennzeichnet auch das Verhältnis der Kapitel zueinander. Während in den Teilen über Semiotik und Phänomenologie vorwiegend prominente Wissenschaftler – Umberto Eco, Erika Fischer-Lichte, Gay McAuley, Edmund Husserl – referiert werden, hat das Kapitel über "Aufführungsanalyse als Erinnerungsarbeit" eher Anweisungscharakter. Das klingt dann so: "Das Lesen kann sich als stille Lektüre des eigenen Protokolls oder dessen anderer vollziehen. Es kann aber auch als lautes Vorlesen in Gruppensituationen vonstattengehen." (Eine stilistische Bewertung solcher Vorschläge verkneifen wir uns.)
Der Wissenschaftler als Kritiker?
Hilf- und aufschlussreicher als die Verallgemeinerungen sind in diesem Buch tatsächlich die eingeschobenen Beispielanalysen, etwa einer Inszenierung von "Maß für Maß" durch Florian Fiedler in Hannover, einer Inszenierung von "Ödipus der Tyrann" durch Romeo Castellucci in Berlin oder von "BRACE UP!" der New Yorker Wooster Group. Dann wieder verliert sich die Darstellung im Einzelfall – etwa wenn die Problematik der gegengeschlechtlichen Besetzung am sehr spezifischen Exempel von Frank Castorfs Inszenierung von "Des Teufels General" mit Corinna Harfouch und Sophie Rois abgehandelt wird.
Gegen Ende des Unterkapitels über den "Text als Referenz der Aufführung" steht ein Abschnitt, der den Verdacht erweckt, dass die Autoren doch, jedenfalls vorübergehend, den Theaterwissenschaftler als Tageskritiker begreifen. "Gerade deshalb ist es wichtig unbestimmte Erwartungen in der Aufführungsanalyse aufzugreifen und zu untersuchen, weil sie dem analysierenden Zuschauer oder der Zuschauerin vor Augen führen, wodurch seine oder ihre Wahrnehmung bedingt ist und zugleich Hinweise darauf geben, wie eine konkrete Inszenierung mit stereotypen Vorstellungen und kulturellen Vorurteilen operiert. Die Auseinandersetzung mit der Differenzerfahrung weist so auf das Spezifische der jeweiligen Inszenierung hin, hilft es zu entdecken und in seiner Eigenart zu beschreiben und schließlich auch zu bewerten." "Auch wenn Theaterkritiken im Feuilleton und Aufführungsanalysen in der Theaterwissenschaft prinzipiell unterschiedliche Textsorten bedienen" – so die Autoren im kurzen Abschlusskapitel: Wo, wenn nicht in der Theaterkritik, träfe der professionelle Analytiker einer Aufführung auf den Zuschauer oder die Zuschauerin, wo, wenn nicht eben da, wäre das Spezifische einer Inszenierung zu bewerten?
Aufführungsanalyse. Eine Einführung
von Christel Weiler/Jens Roselt
A. Francke (utb 3523), Tübingen 2017
387 Seiten, 26,99 Euro
mehr bücher
meldungen >
- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
neueste kommentare >
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch
-
Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise
-
Pygmalion, DT Berlin Schwieriger Vergleich
-
Pygmalion, DT Berlin Schade
-
Pollesch-Abschied Volksbühne Unangebracht
-
Okada in Tokio Schon in München großartig
-
Pollesch-Abschied Volksbühne Platzhirsch-Auftritte
-
Asche, München Link-Hinweis
-
Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around


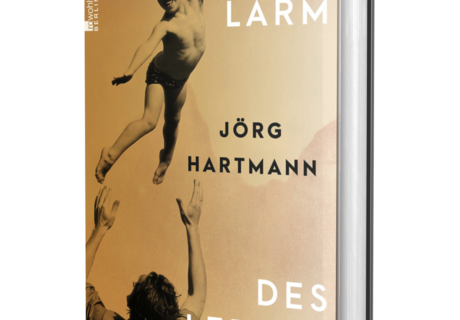
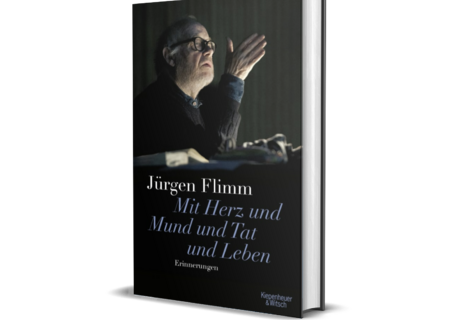
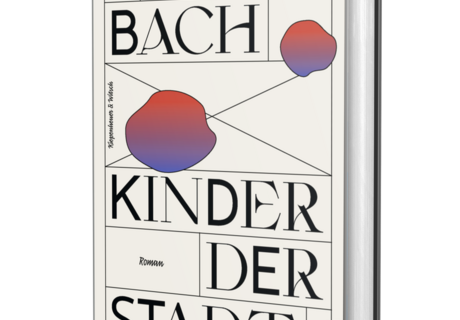
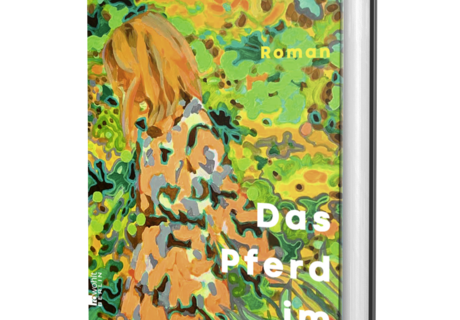
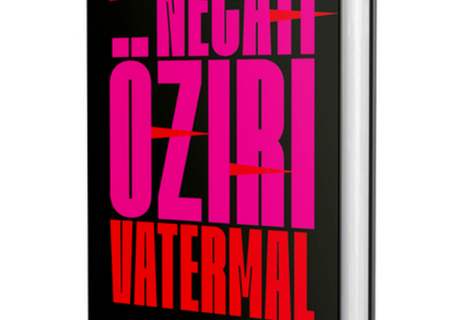






Lieber Thomas Rothschild - auch ich muss die Theaterwissenschafts-Studierenden aller Geschlechter vor Kitasprech von DozentInnen in Schutz nehmen: bei MedizinstudentInnen z.B. geht auch keiner davon aus, dass die Medizin studieren, weil immer Krankenbesuche ihr liebstes Hobby waren/sind und trotzdem erzählt ihnen keiner hauptsächlich wat dat allet wichtig ist, was sie da vorhaben. Für die Menschheit und so. Die haben dafür auch gar keine Zeit sowas Edles von sich zu denken, die haben zunächst erst mal ein Physikum zu schaffen- und das hat sich aber anders gewaschen als gemeinsame Vorleserunden in Seelenplüschambiente!
Auch dass die Analyse von Regie und Interpretation in diesem Buch angeblich "lediglich einen "Exkurs" von eineinhalb Druckseiten" ist fachlich absolut richtig. Regie ist im besten Fall nie Bestandteil der Aufführung, gute Regie verschwindet mit dem Tag der letzten Probe. Und Interpretation ist Sache des Betrachters.
Und was Husserls Bedeutung für Analysen in Wissenschaften jeglicher Art betrifft: Mein letztes Gespräch über Husserl hatte ich vor jetzt 26 Jahren mit einem studierten Philosophen, der nach 10 Jahren exmatrikulärem Erholungsaufenthalt auf Gomera o.ä. zurückgekehrt nach Berlin über ausgerechnet Husserl promovieren wollte. Ich denke, er hat das trotz meiner Einwände auch geschafft. Der Berliner Geist ist groß, frei und ja gern wenig util.
jetzt werdet ihr aber ganz schön trivial. Klar, braucht es eigentlich für nichts Spezialist*innen, weil es ja in nahezu jedem Segment welche gibt, die das auch ganz ohne jede überprüfbare Expertise können. Blöd ist nur, dass die zwar mal bejubelt und mal ausgebuht werden können, leztlich aber, da ja allesamt fröhliche Dilettanten, nicht als Basis für eine profunde Auseinandersetzung taugen, weil das ja weder per verbriefter Expertise, noch per Absichtserklärung ihre Aufgabe ist. Wenn also alle viel Ahnung haben, oder vielleicht ja auch keiner und jedes kollektivere Nachdenken, so gesehen, ein Glücksfall ist, dann ist doch gut, wenn sich welche, mit den Füssen fest auf dem Boden, aus dem Fenster lehnen und Inhalte/Techniken zur Diskussion stellen.
Und klar ist Meinungsbildung qua Theaterbesuch auch für TW-Studierende gut, aber - das passiert doch schon längst! Auf welche Hochschulen und Institute berufen sie sich denn, wenn sie dieses uralte Klischee vom TWler bedienen, der nie ein Theater bei laufender Vorstellung betritt? Das finde ich zu billig, was sie hier im Kaffeehauston von sich geben. Da fand ich ihre Buchkritik sehr viel seriöser, weil sie - im Bewusstsein auch methodisch nachvollziebar sein zu müssen - transparent und damit durchlässig für Diskussion ist. Nichts anderes ist es, was TWler und andere Kulturwissenschaftler versuchen zu trainieren - für welche professionelle Anwendung später auch immer.
Und was genau bedeuten die warum genau für den Gegenstand über den sie ausgestellt werden? -
Was genau sind Expertisen, die von Hochschul-Experten über z.B. Spezialistentum ausgestellt werden, warum und wie viel genau wert?
Woher wissen Sie gewiss, dass es prinzipiell für eine Wissenschaft wertvoller ist, sich nur dann aus Fenster zu lehnen, um Inhalte/Techniken zur Verfügung zu stellen, wenn man ganz fest dabei mit den Füssen auf dem Boden steht?
Auf welchem Boden? Können Sie was zur konkreten Beschaffenheit dieses Bodens sagen oder zu der Beschaffenheit von Füßen, die auch auf einem unbekannten Boden, Neuland zum Beispiel, ganz fest stehen können?
Bitte: zwar ist unsere Unterhaltung trivial, aber wenn Sie sich schon in diese einmischen - herzlich willkommen, auch eine Buchtel? - dann unterscheiden Sie bitte Thomas Rothschild und mich: ER hat ein Klischee - und m.E. rethorisch - bedient was TW, die EVENTUELL keine Vorstellung besuchen,angeht, nicht ich. ICH habe das der persönlichen Freiheit eines jeden TW-Studierenden, und zwar durch interdisziplinären Vergleich begründet, überlassen, ob er Theater bei laufender Vorstellung nun besucht oder nicht...
Es gibt auch den Vorgang, dass ein Bewusstsein sich anstrengt, wenn ihm etwas keine Ruhe lässt, was ihm zunächst eigentlich intransparent und methodisch wirr erscheint. Es hat dann eine Ahnung von einer höheren, dem Betrachteten innewohnenden Ordnung, das es als Erkennens-Herausforderung annehmen möchte aus ganz persönlichen Gründen. Wenn ich Sie richtig verstehe, olympe, versuchen TWler und andere Kulturwisenschaftler Gegenstände der Geisteswissenschaften so darzustellen, dass sie im Bewusstsein g e n e r e l l methodisch nachvollziehbar sein müssen, und zwar explizit zu diesem einen Zweck, dass sie so transparent sind, dass grundsätzlich jedermann über sie diskutieren kann???
Wenn das der Fall wäre, wäre die Kulturwissenschaft der Totengräber der Kunst. Und zwar, weil es methodisch dem Publikum/Zuschauer/Hörer die Ahnung und dessen Funktion für die Bewusstseinsbildung - einschließlich der von Selbst-Bewusstsein - austreiben wollte...
Das verstehe ich.
Weder ich noch Herr Rothschild haben jedoch behauptet, dass die Kommunikation über Theater selbst Theater ist. Obwohl es immer häufiger im Theater Spielweisen gibt, bei denen die Kommunikation über Theater auch Theater ist oder zumindest behauptet, Theater zu sein. Das heißt also: Kommunikation über Theater KANN auch Theater sein und das bedeutet, dass sie nicht zwangsläufig KEIN Theater sein kann...
Aber woher nehmen Sie beim Kommunzieren die absolute Sicherheit, dass die Kommunikation, also zum Beispiel eine Kritik, auch in der Zeitung veröffentlicht wird? Das heißt, dass eigentlich nur dann eine Kommunikation im Bewusstsein einer Veröffentlichung stattfinden kann, wenn die Kommunizierenden S I C H E R sein können, dass ihre z.B. Kritiken oder theaterwissenschaftlichen Erörterungen veröffentlicht werden.
In allen anderen Fällen müssen sich die Kommunizierenden mit ihrem reinen WillenHoffenWünschen veröffentlicht zu werden, begnügen. D.h. ihnen muss allein die MÖGLICHKEIT, veröffentlicht zu werden für ihr Denken und ihr Schreiben genügen. Das ist - werden Sie zugeben, die Mehrheit derer, die in der Lage wären, sich qualifiziert über Theater zu äußern.
Und die Frage ist also, ob diejenigen, die mit der größten Reichweite veröffentlichen, weil sie die entsprechenden Produktionsmittel dafür verfügen auch ganz grundsätzlich die wertvollsten Beiträge über das Theater liefern. Oder ob möglicherweise bei der übergroßen Auswahl von nicht veröffentlichungssicher Schreibenden/Redenden sich nicht gar für den Fachbereich und für die Bildung der Allgemeinheit wertvollere, weil schlüssigere und mit besser gewählten Beispielen ausgestattete Kommunikationsversuche über Theater fänden, als eben die derjenigen Schreibenden undoder Redenden, die in dem Bewusstsein veröffentlicht zu werden Kritiken oder z.B. Kommunikationsregularien über Theater schreiben.
@IB: Ich nehme überhaupt keine Sicherheit von irgendwoher, gehe aber davon aus, dass z.B. Herr Rothschild vorher weiss, ob er eine Kritik auf nk veröffentlicht, oder im Freundeskreis zum Besten gibt, und auch einem TW-Studierenden würde ich jederzeit zutrauen, dass er das Studium mit professionellen Absichten betreibt und also auf etwas hinauswill, wofür es sich lohnt analytische Intrumente und ihre Wirkung zu vestehen.
I c h möchte hingegen auch darüber kommunizieren im Zusammenhang mit Lehrbuch-ähnlichen im weitesten Sinne kulturwissenschaftlichen Veröffentlichungen (wie dem oben besprochenen "Aufführungsanalyse- ..."), ob deren Skripte im Bewusstsein, veröffentlicht zu werden erstellt wurden ODER ob sie im Bewusstsein einer lediglich vagen Möglichkeit der Veröffentlichung entstanden sind.
Und darüber kommunizieren, ob sich aus genau diesem Unterschied etwa inhaltliche und formale Standards für Veröffentlichungen durch Verlage ableiten ließen. Standards als Vorbedingungen für Verlags-Veröffentlichungen, die der Wissenschaft u.U. dienen können ODER auch nicht.
Ich habe bitte TW-Studierenden nicht unterstellt, sie würden nicht mit einer Professions-Absicht studieren. Sondern lediglich ihre nötig zu absolvierenden Lernmühen, bis sie in eine Professionalisierungsphase eintreten, mit denen von Medizin Studierenden verglichen. Wenn ich beides miteinander vergleiche, ist selbst bei komplizierter aufbereiteten Analyse-Studieninhalten in der Theaterwissenschaft weitaus schneller ein öffentlichkeitstauglicher Professionalisierungsgrad erreichbar als für z.B. Medizin Studierende. Für die es um das Lernen vergleichsweise weit komplizierterer Studieninhalte geht, BEVOR sie überhaupt zum eigentlichen Analysieren - nämlich dem Üben von Diagnostik - überhaupt kommen können.
Ich werde einfach folgenden Eindruck nicht los: je einfacher und nahezu populärer in den Kulturwissenschaften Lerninhalte aufbereitet werden, je schneller empfinden sich die Studierenden und Absolventen als professionell.
Und eben das halte ich der effektiven Erforschung von Kunst- und Kultur und ihrer gesellschaftsrelevanten Wirkung wie auch umgekehrt, der Erforschung der Wirkung von gesellschaftlichen Verhältnissen auf die Entwicklung der Künste und der Tradierung von Kulturen für abträglich.
Es ist bitte nur eine persönliche Wahrnehmung von m.E. zunehmend populär aufbereiteten Veröffentlichungen im Bereich der Theaterwissenschaft und eine persönliche Meinung dazu.
Ich kann mich natürlich irren. Meine Wahrnehmung könnte gestört sein, ich könnte eine Anlage zur Hysterie haben, zu wenig Leseerfahrung in den Wissenschaften - zumal den Kulturwissenschaften oder überhaupt für Analyse völlig ungeeignet sein...
@Herr Steckel, wollen Sie damit eher zeigen als sagen, dass somit auch viele von den heute frisch ausgebildeten Theaterwissenschaftlern tendenziell funktionale Analphabeten sein könnten, denen selbst einfachere Texte nicht zugänglich wären? (Was eine eigentlich sinnentstellende Formulierung ist. Denn sie - die funktionalen Analphabeten, kommen ja an solche Texte heran. Nur diese Texte nicht so recht in sie hinein. Grammatisch richtig müsste es also heißen: "..., die selbst einfacheren Texten nicht zugänglich sind." - Es scheint selbst im Bildungsministerium der BRD Schwächen mit der gesetzlich festgelegten Verkehrssprache zu geben, wenn Sie und die "junge welt" richtig zitieren.) - Im Übrigen diskutieren wir über Thomas Rothschilds Kritik an einem neuen Fachbuch, das sich für die Ausbildung von Theaterwissenschaftlern, die sich eben in der professionellen Erprobungsphase befinden, empfiehlt.
Wir kommen aber vom Thema ab und das wird die Redaktion gar nicht gut finden. Es hat so gar nichts mit Theater und Theaterkritik zu tun- Im Zweifelsfalle also: Buchteln. Sie erinnern sich gewiss an die leicht bittere Aussage der Weigel auf die Frage nach ihrem Beitrag am Werk Brechts: "Ich habe gut gekocht."