Regisseurstheater - Gerhard Stadelmaiers essayistische Versuche, den Zeitgeist zu begreifen
Ein Zeitgeisthändler
von Dirk Pilz
11. Juli 2016. Auf dem Tisch liegt ein schmales Bändchen, mintgrün, pappgebunden. Es ward von einem Theaterkritiker verfasst, den das Rentenalter aus dem Amt vertrieb. Ein in den informierten Kreisen sattsam bekannter Mann, der stets vorgab, einer "radikalen Subjektivität" zu folgen und Kritik als "Kunst der Autonomie" zu betreiben, was allerdings zumeist darauf hinauslief, das private Meinen schon als subjektives Urteil und das ungeschützte Vorurteil bereits als Ausdruck von Autonomie zu nehmen. Im Grunde eine tragische Figur, die das Gefängnis des Geschmäcklerischen kaum je zu verlassen vermochte.
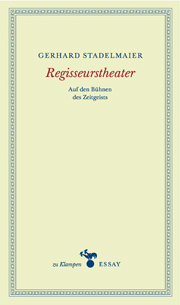 Gerhard Stadelmaier, machthabender Theaterkritiker der FAZ von 1989 bis 2015, hat deshalb selten über Theater geschrieben, meist über sich und seine Theatervorlieben, auch seine Wünsche, Träume, Hoffnungen. Das machte ihn zum Gegenstand der Furcht wie des Mitleids – seine Kritiken haben mich immer amüsiert und abgestoßen gleichermaßen.
Gerhard Stadelmaier, machthabender Theaterkritiker der FAZ von 1989 bis 2015, hat deshalb selten über Theater geschrieben, meist über sich und seine Theatervorlieben, auch seine Wünsche, Träume, Hoffnungen. Das machte ihn zum Gegenstand der Furcht wie des Mitleids – seine Kritiken haben mich immer amüsiert und abgestoßen gleichermaßen.
Reine Willkür
Aber lassen wir beiseite, was sie zumeist prägte, die Eitelkeit, der Dünkel, die Rechthaberei und Rachsucht. Schauen wir, was er schreibt. Der Band heißt "Regisseurstheater", er versammelt zwölf kürzere Essays aus dem näheren und weiteren Umfeld des Theaters und Feuilletonismus. Das erste Wort lautet "Zeitgeist", es ist der Leitbegriff aller hier versammelten Texte. Zeitgeist sei, sagt Stadelmaier, "reine Willkür wie reine Flüchtigkeit".
Was unter einer unreinen Willkür und unreinen Flüchtigkeit vorzustellen ist, sagt er leider nicht. Stattdessen stellt er sich ihn, den Zeitgeist, als Schauspieler vor. Wie dieser trage er Masken und sei durch die Angst geprägt, "von gestern zu sein". Schauspieler seien demnach "Zeitgeisthändler", vorzustellen als "Dealer des Augenblicks", das jedoch in Abhängigkeit davon, "wer gerade Regie führt": Dem Zeitgeist gerate, was gegenwärtig ist, zum Fetisch. Der Zeitgeistspieler sei demnach einzig mit dem "Auskotzen der Gegenwart" beschäftigt.
Es folgen einige pauschale Anmerkungen zum Wesen des "Angesagten", und gern hätte ich hier gewusst, wie sich das "Auskotzen" zur "wohligen, frivol sozialverträglich passiven Haltlosigkeit" verhält, die den Zeitgeist Stadelmaier zufolge auch bestimmt, was also passives Entleeren (Auskotzen) sein soll, denn ist es passiv, kommt es einer Krankheit gleich, die allerdings gerade das Gegenteil aller Maskerade abgibt – Kranksein bedeutet auch, aller Masken verloren zu gehen.
Kann es sein, dass Stadelmaier schlicht alle begrifflichen und phänomenologischen Unterschiede zwischen Moden, Markt und Zeitgeist ignoriert? Dass bei ihm das "Gefühlte in den Zustand des Gewussten tritt", was er jedoch wiederum als Kennzeichen des geschmähten Zeitgeistes nimmt?
Ein Statthalter
Sein Gegenbegriff zum Zeitgeistigen ist der "Stehenbleiber", nämlich "seltenes Exemplar" und "kostbare Erscheinung" zugleich. Auf ihn trifft indes zu, was wiederum für den Zeitgeist gelten soll: Er ist Produkt seiner Zeit. "Was man den Geist der Zeiten nennt, wird gemacht", schreibt Stadelmaier. Er macht auch den Stehenbleiber, weil es ihn nur in dezidierter Absetzung vom Gegenwartsauskotzer gibt. Der Stehenbleiber wird so jedoch zum lautesten Fürsprecher des Zeitgeistes auf den Bühnen der Gegenwart – mit dieser vertrackten Dialektik beginnt das Problem des Zeitgeistes ja erst. Es taucht bei Stadelmaier nicht auf, was ihm den Vorwurf einhandelt, den Zeitgeistbegriff lediglich als Statthalter von Ressentiments zu benutzen.
Übrigens bezieht er sich, wie häufig, hier auf Lessing und Goethe. Das ist fraglich genug. Womöglich hätte es geholfen, auch Herder und Hamann zu studieren, um sich in dialektischer Gegenwartsanalyse zu schulen, weil gerade bei ihnen zu lernen ist, den Fallen eines geschichtsblinden Grollens wider die Gegenwart zu entkommen.
Bewusstlos vorgemacht
Leicht ließen sich nun die Ausführungen Stadelmaiers als feuilletonistisches Lockendrehen abtun, er versteht ja stets, flott zu formulieren. Aber in einem weiteren Text demonstriert er, dass auch das unbedarfte Denken nach Konsequenzen verlangt. In ihm attestiert er der Kanzlerin Angela Merkel, dass sie mit ihrem "Wir schaffen das!"-Satz einem "der mächtigsten Zeitgeistmittel" erlag: der Rührung. Sie ist, nach Stadelmaiers Logik, eine Zeitgeistspielerin, die nicht weiß, dass sie es ist.
Er vergleicht Merkel mit Lessings Nathan: "Nathan ist Subjekt eines Prozesses, die Kanzlerin Objekt einer Plötzlichkeit. Nathan weist auf eine Realität scharf hin. Die Kanzlerin sieht von einer Realität ab. Nathan hat bewusst etwas vorgedacht, die Kanzlerin hat bewusstlos etwas vorgemacht."
Abgesehen davon, dass Stadelmaier damit jede historische Distanz einebnet, als wolle er der sonst von ihm zu Recht angeklagten Geschichtsvergessenheit zu Ehren verhelfen, abgesehen auch davon, dass er die Unterschiede von Mensch und Figur übergeht, als wolle er sich zum Anwalt des durch ihn obsessiv lächerlich gemachten Dokumentartheaters erheben, behauptet Stadelmaier hier implizit, dass sich aus der Literatur geradewegs Handlungsanweisungen ableiten lassen. Die Politik mag sich zwar theatraler Techniken bedienen und die Literatur politische Strukturen sichtbar machen, die Unterschiede von Ästhetik und Politik, Kunst und Leben aber derart zu übergehen, verstellt jede Chance auf Erkenntnis – und redet einer verheerenden Gleichmacherei das Wort. Wohin das führt, lässt sich in der Geschichte studieren.
Ein fremder Kontinent
Was soll man also von Essays halten, die alles durcheinanderwerfen und die Begriffe handhaben wie ein Stück knetbare Masse je nach Bedarf? Sie machen den Eindruck, als habe Stadelmaier schlicht aufgeschrieben, was ihm durch die Rübe rauscht, als wäre er der herausgehobene Selbstdarsteller auf der Bühne genau jenes Theaters, das er mit dem glücklichen Begriff "Regisseurstheater" belegt hat.
Das Regisseurstheater, sagt er, "füllt den leeren Raum mit dem Regisseur, der sich selbst zum Kontinent erklärt". Und alles, was auf diesem nicht vorkommt, sei ihm "unbekannt wie ein fremder Kontinent". Das trifft es sehr schön und trifft noch schöner die Texte in diesem Band, die stets nur in den Vorgärten des eigenen Denkens im Kreis gehen, jeden Zweifel und Einwand, jedes Argument gegen das Eigene ängstlich meiden. "Nicht ungedacht lassen, was gegen deinen Gedanken gedacht werden kann", war die Arbeitsmaxime Nietzsches. Die Texte dieses Buches sind gemessen daran Arbeitsverweigerung.
Oder besser, man nimmt sie als Unterhaltungsliteratur, nicht als Denk-Stücke. Ende September diesen Jahres erscheint Stadelmaiers erster Roman, "Umbruch" betitelt, angekündigt als "eine Art literarische Autobiographie". Sicher lustig.
Gerhard Stadelmaier
Regisseurstheater. Auf den Bühnen des Zeitgeistes
zu Klampen Verlag, Springe 2016, 133 S., 16 Euro
mehr bücher
meldungen >
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
neueste kommentare >
-
Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog
-
Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde
-
Zusammenstoß, Heidelberg Weg ins Museum
-
Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?
-
Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater
-
Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude


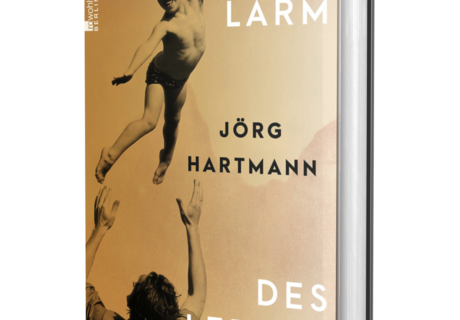
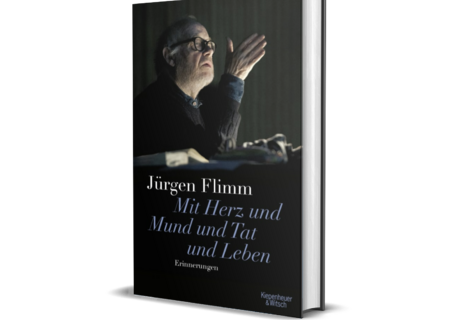
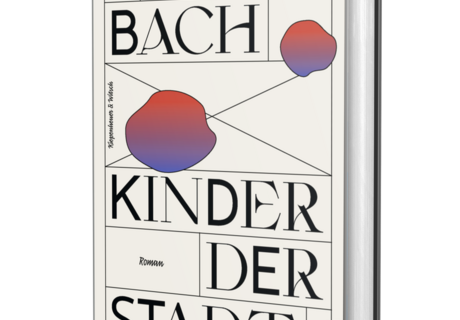
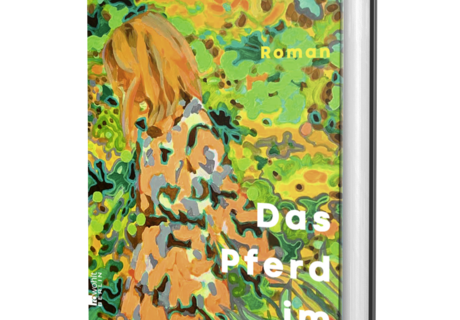
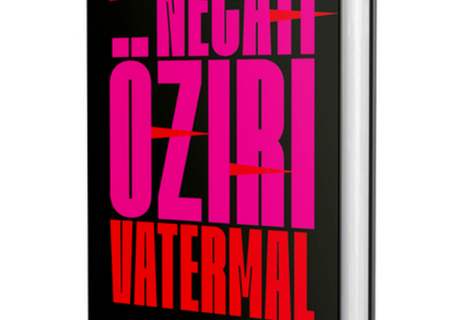






Auf welchen Abschnitt der Geschichte bezieht sich der Rezensent? Und möchte der Rezensent Gerhard Stadelmaier ernsthaft eine Haltung unterstellen, deren "verheerende" Konsequenzen sich in der Geschichte studieren lassen? Weil der Merkels Flüchtlingspolitik offenbar töricht findet? Ist das etwa nicht "verheerende Gleichmacherei"?
Grusel grusel.
Ansonsten heißt es "...Kranksein bedeutet auch, aller Masken verlustig zu gehen". - Es ist auch mit dem Kritik-Stilmittel "Imitieren altmodischer Ausdrucksweisen" nicht so einfach! Nicht einmal für einen Profi wie Dirk Pilz... Mein persönlicher Schluss wäre, dass ich lieber ein Scheiß-Theater habe, in das ich nicht gehe als ein Kotze-Theater bei dem mir schon schlecht wird, wenn ich nur davon lese!
Selbst in Pilz' Zerrbild sind Stadelmaiers Gedanken noch anregender und schlüssiger als die Kritik an ihnen. Auch stilistisch ist der Rezensent hoffnungslos unterlegen.
So nervig idiosynkratisch Stadelmaier sein mag, angesichts solcher zweitklassiger Verrisse vermisst man ihn.
Das Stadelmaier 'Problem' war immer, ihn auf seiner Höhe zu erwischen - hoch gekommen ist da niemand. Der grosse Mann fehlt!
uninspiriert, langweilig, aus einem Proseminar für Kulturtheorie. Die Auslöser dieser Kritiken will man gar nicht mehr sehen...
Ich bin sehr froh, dass sich hier mal jemand die Mühe gemacht zu schauen, was genau Stadelmaier eigentlich schreibt, und siehe da: der König ist nackt. Das ist ja das Entscheidende: was einer sagt. Vielleicht sollten Leute wie Heinse und Hyperion mal lesen und nicht nur irgendeine "Höhe" anhimmeln? Und sie sollten was zu sagen haben, nicht nur diffamieren. Das war schon bei Stadelmaier immer langweilig, dass er zu Beleididungen griff wo Argumente gefordert waren.
Ergebnis davon ist der wabernde French-Theory-Nebel, aber auch pseudopräzise Begriffsanalytik und ein Adorno-für-Arme-Stil, wie ihn die Pilze des Feuilletons produzieren. Wissenschaftshokuspokus.
Bei der Kritik zählen genaue Beobachtung, der Sprachwitz, das Argument, die Dramaturgie. All das bildet eine Einheit. An guten Tagen war diese Verbindung bei Stadelmaier großartig. An schlechten blieb er tatsächlich in seinen Ressentiments stecken, und dass er Geschmacksblockaden hat (Bondy und Breth wurden als Beispiel genannt, auch bestimmte Autorinnen bejubelte er häufig, etwa Theresia Walser oder Yasmina Reza), lässt sich kaum leugnen.
Aber immerhin zeigt er sie offen. Das ist mir allemal lieber als dieses verkniffene (und sterbenslangweilige) Objektivitätsgeheuchel "wissenschaftlicher" Kritiker. Da wundere man sich noch, dass niemand mehr Kritiken liest!
Stadelmaier seine Stilisierung zum Unzeitgemäßen vorzuwerfen, ist wiederum ein erbärmlicher Zirkelschluss. Gerade für seine faktische Unzeitgemäßheit wird er doch gehasst! Die Frage ist eben nur, ob man diese Eigenschaft positiv oder negativ bewertet.
Wenn aber der Kritiker nur das Medium für den Zeitgeist sein soll, kann man auch gleich auf ihn verzichten. Dann reicht es, andächtig dem täglichen Gebrabbel zu lauschen und sich ins weiche Bett der totalen Affirmation fallen zu lassen.
Ungerecht ist auch der Vorwurf, Stadelmaier habe sich selbst wichtiger als das Theater genommen. Er hatte schlicht und einfach eine klare - und alles andere als spießige, sondern vielmehr im Guten wie im Schlechten romantische - Vorstellung davon, was Theater leisten kann und sollte.
Noch ein Wort zur Mahnung, man sollte doch den Essay zum "Regisseurstheater" erst einmal eingehend studieren, bevor man sich dazu äußert. Der Rezensent eröffnet seine Besprechung mit einer Pauschalpolemik, die nichts mit dem Buch zu tun hat. Im Folgenden behält er diesen Stil bei. Damit setzt er den Rahmen der Debatte.
Was ist also eine gelungene Kritik? Sicherlich keine, die kläglich im Treibsand ihres eigenen Räsonierens versinkt. Auch in der Deskription kann sie verloren gehen, dann bleibt vom Theater nichts als ein totes Bild. Genauso öde ist das rein kasuistische Urteil, hinter dem keine Reflexion über das Theater und seine Erkenntnismöglichkeiten sichtbar wird. In seinen Glanzmomenten war Stadelmaiers Wüten sicher weit näher an der gelungenen Kritik, als es die meisten seiner Kollegen je sein werden.
Übrigens hat die FAZ mit Simon Strauss mittlerweile einen interessanten jungen Autor, dessen Texte mir bereits mehrmals positiv aufgefallen sind. Keine Stadelmaierattitüde. Aber stets ein roter Faden, sinnliche Beschreibung und ein feines, eigensinniges analytisches Gespür für größere Zusammenhänge. Auch so kann gelungene Theaterkritik aussehen.
...
Im Gegensatz dazu wird Stadelmaier hier doch nur wieder genannt, und zwar von allen Diskutierenden, weil es nun meinem Gefühl nach wieder stellvertretend um dieses Dercon-Castorf-Thema gehen kann. Das jedenfalls lese ich heraus. Französische Theorie ist nicht immer nur schlecht, das Geblubber nervt schon, das kann ich mittlerweile auch bestätigen, aber immer nur Brecht und Piscator und sogenanntes "Arbeitertheater", das passt irgendwie auch nicht mehr in die Zeit. Es gibt einerseits einen Unterschied zwischen Zeitgenossenschaft (und die ist immer wieder, für jede nachwachsende Generation vergänglich) und Kulturkapitalismus-Lifestyle-Moden. Und andererseits einen Unterschied zwischen Zeitgenossenschaft und Vergangenheitsnostalgie, welche ich Stadelmaier attestieren würde. Der ist doch nicht romantisch, der ist altbacken ...
"Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde."
Nebenbei bemerkt: So mancher Regisseur bringt mit großer Geste derart wirren, aus fashionablen ästhetischen Formeln zusammengeklaubten eklektizistischen Mist auf die Bühne, dass es Realsatire wäre, dem Versuch noch mit Respekt und Einfühlung zu begegnen.
Der Kritiker ist nicht der Psychotherapeut der Theatermacher. Was man von ihm erwarten kann, ist, dass er sich genauso nackt macht und sich mit demselben vollen Einsatz in die Sache reinhängt, mit ihr ringt, wie es idealerweise die Autoren, Regisseure und Schauspieler tun. Und das haben die besten Empörungsexzesse Stadelmaiers sicher geleistet. Denn wer sich aufregt, ist niemals auf billige Weise souverän. Das sind nur die Lauen.
Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Wissenschaftsattitüde der Sache eher schadet als nützt. Das heißt, eine epistemologische Formenstrenge zu behaupten, die tatsächlich nicht existiert.
Schon die Krise der Geisteswissenschaften ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem guten Teil selbst herbeigequatscht worden, indem man wortreich mit der mangelnden Präzision der eigenen Disziplin haderte, anstatt selbstbewußt für kluge Essayistik als adäquates Analyseinstrument für Literatur, Theater etc. einzutreten.
Als Allheilmittel sollte dann die Austreibung des Geistes, die Kulturalisierung aller Phänomene dienen.
Am Ende sind wir aber trotzdem Individuen. Und was in unserem Kopf passiert, die ästhetische Erfahrung – darauf kommt es an. Dem Geist können wir nicht entkommen, wenn Literatur, Theater oder Musik irgendwas bedeuten sollen. Um diesen blinden Fleck kreist alles Streiten über Kunst, dessen Reiz doch gerade darin liegt, dass es in der Grauzone zwischen Rationalität und Affekt stattfindet. Denn dort sind wir existentiell betroffen. Mag ja sein, dass einer wie Stadelmaier heute altbacken wirkt. Wenigstens glaubt er ans Theater, was zwangsläufig heißt: an die Notwendigkeit, darüber zu streiten.
Es gibt tausend Arten, interessante Kritiken zu schreiben. Aber Engagement, reflektierte Subjektivität, Drive – sowas braucht man, sonst wird nichts draus. Nichts ist schlimmer als selbstreferenzieller Akademismus.
Ich will abwechslungsreiche Geisteslandschaften statt öder Metaebenen.
Aber erstens wüsste ich gern, welche Theaterkritik(er) Sie eigentlich meinen - ich kenne keine Theaterkritik, die in so karikiert "wissenschaftlich ist"
Zweitens geht es gerade darum: kluge Essayistik. Und klug sind diese Essays von Stadelmaier hier eben nicht. Sie haben Drive, aber keinen Geist. Sie haben eine schillernde Oberfläche, sind leidenschaftlich, aber der Inhalt ist sehr dünn.
Niemand sagt, dass es "öde Metaebenen" braucht, niemand ist gegen abwechslungsreiche Geisteslandschaften - und an die Notwendigkeit, über Theater zu streiten, glauben viele. Entscheidend ist, was man zu sagen hat, nicht allein die Leidenschaft dafür. Sonst ist es eben wie bei Stadelmaier: nichts als funkelnder selbstreferentieller Feuilletonismus.
Außerdem halte ich diese Gegenüberstellung von hier Leidenschaft/Stadelmaier und dort "die" langweilige, akademische etc. Kritik für plumpes Pauschalisieren - da wünsche ich mir doch ein bisschen analytischen Geist, um nicht in so schlichte Schubladen zu denken.
Ob nun Politik oder Psychologie – am Ende geht nichts ohne Ästhetik, sonst kann man aufs Theater gleich verzichten. Stadelmaier will auf der Bühne eine Gegenwelt sehen, und so weit gehe ich mit ihm. Seine Kriterien für die Entscheidung, ob etwas als eine gelungene Gegenwelt gelten kann oder doch als banale Regisseursbefindlichkeit abgestempelt werden muß, mögen tatsächlich teilweise altbacken oder gar reaktionär sein.
Aber wenn ich mir z.B. den Maxim-Gorki-Happeningschuppen anschaue, dann denke ich schon, dass er zumindest im Grundsatz für etwas richtiges kämpft. Um Diskussionsrunden über Diskriminierung, Selbstmitleidspodien für Minderheiten oder Culture-Clash-Klamotten zu veranstalten, braucht man kein Theater. Wenn man eine Form für diese Fragen findet – gern! Aber die Form muß eben schon sein, und sie muß den Freiraum für Mehrdeutigkeiten, für Ambivalenzen, fürs Abgründige, das jeden angeht eröffnen, eben den Freiraum der Ästhetik.
Am Gorki werden stattdessen nur nochmal alle Moden der Irgendwas-mit-Ethnie-Religion-Gender-und-Sozialem-Studies "performativ" runtergebetet. Das – hier auch noch moralisierende – Wissenschaftlichkeitsgetue als Duplikat live on stage.
Pollesch setzt diesen Slang, diese Denkschablone ja wenigstens bewußt ein, reflektiert und bricht sie. Aber die Leute vom Gorki halten sich tatsächlich für originell, während sie eigendlich nur Besserwisserklischees sich als links verstehender Akademiker reproduzieren. Schon der Name "postmigrantisches Theater" klingt derart unsexy nach Kulturwissenschaft an der HU, dass man sich lieber drei Stunden Robert-Wilson-Kitsch antun möchte. Selbstgerechtes Affirmationstheater wäre wohl treffender.
Und dass man sich in diesen Fragen im Kreis dreht, liegt wohl in der Natur der Sache. Pessimisten nennen es die ewige Wiederkehr des Gleichen. Optimisten nennen es Dialektik.
Stadelmaier und Wilson als Alternativen? Nein, wirklich nicht. Wegen der "Gegenwelten"? Na, aber wo leben SIE denn? In "Gegenwelten" oder in dieser einen Welt, mit der sich das Theater selbstverständlich auseinandersetzt und -setzen muss.
(...) Mittlerweile sind die Gorki-Leute doch längst vom Begriff postmigrantisch abgerückt. Und damit auch von dem, was Sie abwertend mit "Selbstmitleidspodien für Minderheiten" nennen. (...)
Das Wesentliche auf der Bühne ist immer auch universell. Insofern bin ich in der Tat gegen Selbstmitleidspodien für Minderheiten. Denn zum einen entsteht aus sozialwissenschaftlichem Moralismus allein kein gutes Theater. Zum anderen halte ich schon die Basis dieses Moralismus' für falsch. Es ist ein – inzwischen leider epidemischer – Trugschluss zu glauben, die inflationäre Vermehrung der Schubladen führte auch tatsächlich zu mehr Differenziertheit. Menschen mit Labels zuzukleistern, befreit sie nicht, sondern macht sie zur Litfaßsäule.
Wer sich primär über die Rolle der diskriminierten Minderheit definiert, bleibt ein Sklave von Zuschreibungen. Nur das Selbstverständnis als denkendes Individuum setzt frei, nicht die Gruppenidentität. Die Einsamkeit und das Leid, die mit eben dieser Individuation einhergehen, sind elementar fürs Theater. Dieses Ecce homo ist der Fluchtpunkt auf der Bühne. Wird er vergessen, bleibt auch die Klage des Transsexuellen, der Muslima, des Flüchtlings bloße Befindlichkeit.
Was ich mich allerdings frage: Sie scheinen irgendwie ein Problem mit dem Gorki zu haben. Warum, das ist vielleicht das eigentliche Thema hier. Was Sie dann aber auch klarer offenlegen müssten. Das Theater ist so vielfältig und multiperspektivisch wie die Menschen die AUF UND HINTER der Bühne arbeiten. Sind SIE eigentlich ein "Sklave"(bitte?! Sklave von Zuschreibungen?! Ein Sklave hat nur seinen Körper, Zuschreibungen sind gemeinhin NICHT körperlich) oder ein Chef? Ist klar oder was, die Nutte ist ein Sklave von Zuschreibungen oder was, dümmer, manipulativer und undifferenzierter geht's gar nicht.
Schließlich, Einsamkeit und Leid gehen in meiner Wahrnehmung nicht mit dem Thema der Individuation einher, warum auch, sondern vielmehr mit dem Thema der sozialen Situation. Und das betrifft eben doch Gruppen in unserer Gesellschaft und nicht nur einzelne, auch wenn jede/r einzelne in dieser Situation dieselbe dann natürlich jeweils indviduell wahrnimmt. Das hat dann wiederum mit Vorerfahrungen usw. zu tun.
das AUGE GOTTES (?)
nachdem ich vom "teufelsabbiss"-berg(sein älterer name, heute nennt man ihn anders) herunter gekommen war, und mich an seinem fuße auf einer holzbank ausruhte und ich nach einer inneren sammlung vom weg aufschaute, sah ich die tiefstehende SONNE, und einen wolkenstreif, der wie ein augenlid das obere drittel der sonne bedeckte. - links und rechts dieses sonnenauges, sah ich sonnenstrahlen, die schräg zur erde fielen, ganz wie bei den darstellungen des auges der vorsehung(auge gottes oder gottesauge, - ein symbol, welches gewöhnlich als das alle geheimnisse durchdringend allsehende auge gottes interpretiert wir und den menschen an die ewige wachsamkeit gottes erinnern soll, so nur das geschieht, was vorgesehen ist.) - -
nach einiger zeit, ich erinnere mich nicht mehr wie lange es dauerte -
wurde aus dem wolkenauge(sonne)-lidstreifen ein f i s c h. -
ganz deutlich sah ich(ich fantasierte nicht, und war vollkommen nüchtern) die form eines langen fisches . . .
als ich später zur autostraße kam, und mich umwandte und auf den berg zurückschaute, sah ich einen regenbogen, der links neben dem berggipfel(der etwa 18OO meter hoch ist), begann, und sich in einem weiten bogen knapp über den gipfel des berges bis zum darunter liegenden see spannte, und in den wassern des sees endete . . .
am weg zur ortschaft am see(sankt g.) sah ich menschen, die zu diesem regenbogen am himmel emporschauten . . .
jacques: die ganze welt ist bühne
und alle fraun und männer bloße spieler.
sie treten auf und gehen wieder ab. (...)
wie es euch gefällt, von shakespeare.
siebende szene, ein anderer teil des waldes . . .
Im Übrigen gilt: Ob man nun Realist, Konstruktivist oder Nichtsdergleichen ist, bevor man den Satz "die EINE Wahrheit gibt es nicht" unkommentiert in die Landschaft stellt, sollte man dreimal nachdenken. Nach eben diesem – ironischerweise – UNIVERSELL gesetzten Prinzip funktionieren nämlich Putins Russland oder Erdogans Türkei. Wörter sind nur Schall und Rauch, was sie bezeichnen, wird dort je nach Bedarf umdefiniert. So wird Erdogan zum wahren Demokraten (gerade gestern einen seiner Anhänger gehört, der sich für Deutschland auch endlich mal diese lupenreine "Demokratie" wünschte), Krieg wird zu Frieden, Andersdenkende zu Terroristen.
Auch werden Sie ja kaum Strafprozesse für sinnlos halten, weil es die EINE Wahrheit nicht gibt.
Kurzum: Die Sache mit der Wahrheit ist sehr kompliziert, aber es ist gerade eine wesentliche Eigenschaft guter Kunst, dass sie nicht behauptet, die Wahrheit zu kennen, ohne sie deshalb gleich für relativ zu erklären.
Mein Problem mit dem Gorki besteht darin, dass dort größtenteils schlechte Kunst gemacht wird. Und zwar, weil man sie von Grund auf ideologisiert. Sie selbst illustrieren das sehr schön mit Ihrer Verwendung der Begriffe "vielfältig" und "multiperspektivisch". Den Glauben, das Theater – also die Kunst – würde "vielfältig" und "multiperspektivisch", nur weil die Intendantin türkischen Migrationshintergrund hat, der Beleuchter Chinese ist, auf der Bühne schwule deutsche Juden mit orthodoxen Israelis streiten (flankiert von Flüchtlingen als Chor), während die feministische Dramaturgin gerade das vegane Catering eines isländischen Restaurants probiert – genau diesen Glauben halte ich eben für völligen Quatsch.
Dass all diese Menschen am Theater mitarbeiten, ist ja sehr erfreulich. Und die Gesellschaft wird durch sie sicher "diverser". Aber bis zu einem gewissen Grad von sich selbst und ihren Identitätslabels absehen müssen sie genau wie käseweiße Biodeutsche der 346. Generation mit Nazigroßeltern, wenn sie gutes Theater machen wollen.
Im Gorki sind allerdings die Labels, die Schubladen, die sozialwissenschaftlichen Kategorien Kern des Konzepts, und das leider nicht kritisch oder anarchisch (wie etwa bei Pollesch), sondern moralisierend affirmativ. Das ist eher monoperspektivisch und einfältig.
Individuum IST man so einfach wiederum höchstens in seiner biologischen Existenz. Alles, was darüber hinaus geht, muß man werden. Und das ist mit viel Leid und Einsamkeit verbunden, weil man sich nicht in allgemein akzeptierten Gewissheiten und Gruppenidentitäten einrichten kann, wie sie z.B. dem oben zitierten Erdogan-Jünger, der seine Individualität an der Garderobe des islamistisch eingefärbten türkischen Nationalismus' abgegeben hat, ganz unproblematisch zur Verfügung stehen. Und welcher Ort, welches Medium, wenn nicht das Theater, ist denn prädestiniert dafür, vom prekären Verhältnis des Einzelnen zur Gruppe zu handeln? Am Gorki hingegen wird nur die eine große Gruppe in viele kleinere aufgeteilt.
Warum Sie meine Verwendung des Begriffs Sklave so aufregt, bleibt unklar, Ihre Ausführungen wirr. Auch ein "Chef" kann unter Umständen natürlich Sklave sein. Und wenn Sie "Slave" schon unbedingt so konkretistisch verstehen wollen, dann ist es doch gerade der Körper, der versklavt wird. In diesem Sinne "hat" der Sklave nur seinen – individuellen – Geist. Und den sollte er, soweit er kann, benutzen, um die physischen Ketten irgendwann zu sprengen. "Free your mind and your ass will follow" hieß es schon vor über vierzig Jahren bei "Funkadelic".
Natürlich gibt es bzw. muss es bei Strafprozessen die Wahrheit geben. Das ist dann die juristische Wahrheit, belegt über Beweise. Ich sprach aber von etwas ganz anderem, nämlich von der philosophischen Wahrheit. Sie kennen ja sicher auch das Höhlengleichnis von Platon. Der ging davon aus, dass die Höhlenmenschen die Wahrheit nicht erkennen könnten, sondern nur Schatten sehen würden. Aber die Wahrheit spürt man eben doch auch. Körperlich. Wenn man im Schlamm liegt und nach wem ruft? Gott? Oh je. Entschuldigung, ich bin gerade in meinem Kopf zu einer Szene von Wolfgang Herrndorfs "Sand" gesprungen.
Wie heissen SIE eigentlich im richtigen Leben, abs? Sie hauen ja derart auf das Gorki drauf, dass man das nur als Vorurteil lesen kann. Haben Sie eigentlich auch persönlich/privat ein Problem mit Türkinnen, Chinesen, Schwulen, Juden, Feministinnen, Veganern usw.?
Das Auge Gottes, der Fisch (als ein christliches Symbol, auch als christliches Erkennungszeichen), der Regenbogen (der Regenbogen ist von
jeher ein wichtiges Element zahlreicher Mythologien und Religionen über
alle Kulturen und Kontinente hinweg. Die Mythen sprechen ihm dabei oft
die Rolle eines Mittlers oder einer Brücke zwischen Götter- und Menschen=
welt zu. Mythologien ohne Regenbogen sind selten.)
Der Fisch kann archetypisch und tiefenpsychologisch als Symbol für die
(unter Wasser) verborgene Wahrheit gedeutet werden, die es zu fangen, also ans Licht zu holen gilt. Das Symbol bezieht sich auch auf den Satz
aus dem Lukasevangelium: Jesus sagte zu Petrus: Fürchte dich nicht! Du
wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.