William Shakespeare - Neue Bücher zum 450. Geburtstag
Unsern Shakespeare gib uns heute
von Rainer Nolden
19. April 2014. Ein literarisches Weltengenie. Nein, eine Nummer kleiner geht es wirklich nicht. Er hat sie alle in den Schatten geschrieben, seine Vorgänger, die Zeitgenossen sowieso. Und die Nachfolgenden hatten es schwer, aus eben diesem Schatten zu treten und selbst zu leuchten. Ein Leuchtturm, der bis in die unmittelbare Gegenwart hineinreicht – und alles, was nach ihm kam, vor große Herausforderungen gestellt hat. "Nach Shakespeare hätte keiner mehr ein Theaterstück schreiben müssen", seufzte einst Tennessee Williams.
Shakespeare als Mann für alle Gelegenheiten, seine Worte als Vademecum durch die Jahrhunderte. Der polnische Regisseur Jan Kott prägte den Begriff vom "Zeitgenossen Shakespeare" und segelte dabei doch wieder nur im Kielwasser des Schweizer Volksdichters Ulrich Bräker, der bereits 1780 Lust verspürte, über Shakespeares Werke "mit diesem lieben mann (zu) reden als wenn er bei mir am tisch säße".
Jetzt also der 450. Geburtstag, am 23. April vermutlich. 450 Jahre ist es her, seit Englands größter Stolz auf diesem "Kleinod, in die Silbersee gefasst" das Licht der Welt erblickte, in Stratford-upon-Avon, seinerzeit eine prosperierende Marktstadt, heute literarisches Disneyland. Der Jubeltag ist den Theatern freilich kein Grund für einen inszenatorischen Overkill. Es vergeht ohnehin keine Spielzeit, in der nicht mindestens 80 Prozent seiner Werke auf irgendeiner Bühne die Ideen eines Regisseurs überleben müssen. Und egal, wie die Inszenierung ausfällt: Shakespeare überlebt immer!
Es ist alles gesagt?
Die Literatur über Shakespeare: Ein stetig anschwellender Tsunami, bestehend aus Millionen von wissenschaftlichen Artikeln, verteilt über Fachzeitschriften in aller Welt und allen Sprachen, und Zehntausenden von Büchern, die auf den Regalen in Bibliotheken weltweit (und oft vergeblich) auf Leser warten. Die studieren oftmals nur den Index und die Quellen, um sicherzugehen, dass das eigene Thema noch nicht in irgendeiner Dissertation durchgewalkt wurde.
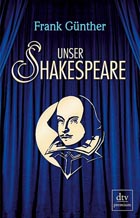 Die Chance ist gering: Wer weiß schon, "ob das, was man da geistig angeregt Originelles denkt, nicht schon längst viel besser, origineller, vollständiger, konsequenter und schöner von anderen gedacht wurde?", fragt Frank Günther – und legt dennoch ein weiteres Buch vor. Mitten hinein in die deutsche Sturm- und Drangseele taucht der Regisseur und formidable Shakespeare-Übersetzer in seinem besitzergreifend betitelten Werk "Unser Shakespeare" ein.
Die Chance ist gering: Wer weiß schon, "ob das, was man da geistig angeregt Originelles denkt, nicht schon längst viel besser, origineller, vollständiger, konsequenter und schöner von anderen gedacht wurde?", fragt Frank Günther – und legt dennoch ein weiteres Buch vor. Mitten hinein in die deutsche Sturm- und Drangseele taucht der Regisseur und formidable Shakespeare-Übersetzer in seinem besitzergreifend betitelten Werk "Unser Shakespeare" ein.
In einer rasanten tour de force eilt er durch den Shakespeare-Kosmos und wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Hat der Dichter wirklich alles selbst geschrieben? Ja, denn was seine Bildung angeht, war er dazu durchaus in der Lage. War er schwul? Möglich, wenn man die Sonette in Betracht zieht. Möglich auch, dass ihn die Liebesszenen in seinen Stücken, in denen ja nur Männer auftraten, auf den Geschmack gebracht haben. Nicht auszuschließen jedoch auch, dass er nur mit literarischen Konventionen spielt.
Noch einmal für's Parkett. Und für die Logen
Bei den Stücken pickt Günther sich jene heraus, mit deren Hilfe er sein Argumentationsgebäude solide aufbauen kann. Mit verblüffenden Brückenschlägen in die Aktualität zeigt er auf, dass sie nicht nur von historischer Relevanz sind. So fände sich der moralinsaure Angelo in "Maß für Maß" von einem Urteil des Bundesgerichtshofs darin bestätigt, den Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten – nun, nicht gerade mit dem Tod zu sühnen, aber zu bestrafen: "Die sittliche Ordnung will, daß sich der Verkehr der Geschlechter grundsätzlich in der Einehe vollziehe …", legen die Bundesrichter fest – 1954!
Und wie besetzt man politisch korrekt den Othello, wenn man nicht einmal das Attribut "Mohr von Venedig" benutzen darf? Als schwarz geschminkten Weißen? Mit einem dunkelhäutigen, klassisch ausgebildeten Schauspieler, der Deutsch bühnentauglich beherrscht? Mit einem weißen, ungeschminkten Schauspieler? Hier spricht Günther, der Theaterregisseur: Er denkt konzeptionell, sucht Bilder und Bildhaftigkeiten, verbindet Jahrhunderte und rettet die Aktualität eines für das moderne Publikum vermeintlich Bedeutungslosen in die Gegenwart.
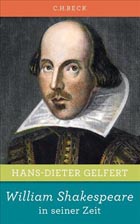 Wäre "Unser Shakespeare" ein Stück fürs Globe Theater, so würde sich der Inhalt zweifellos vor allem an die „groundlings“ richten. Der emeritierte Anglistik-Professor Hans-Dieter Gelfert dagegen hätte mit seiner profunden Untersuchung "William Shakespeare in seiner Zeit" vor allem das Publikum der Logen im Blick. Auf gut 400 Seiten Text plus umfangreicher Bibliografie gelingt ihm das Kunststück, nicht nur das gesellschaftliche, politische und kulturelle Umfeld konturenscharf zu skizzieren, sekundiert von zahlreichen zeitgenössischen Darstellungen, sondern auch jedes einzelne Drama anhand von Entstehungs- und Wirkungsgeschichte zu würdigen.
Wäre "Unser Shakespeare" ein Stück fürs Globe Theater, so würde sich der Inhalt zweifellos vor allem an die „groundlings“ richten. Der emeritierte Anglistik-Professor Hans-Dieter Gelfert dagegen hätte mit seiner profunden Untersuchung "William Shakespeare in seiner Zeit" vor allem das Publikum der Logen im Blick. Auf gut 400 Seiten Text plus umfangreicher Bibliografie gelingt ihm das Kunststück, nicht nur das gesellschaftliche, politische und kulturelle Umfeld konturenscharf zu skizzieren, sekundiert von zahlreichen zeitgenössischen Darstellungen, sondern auch jedes einzelne Drama anhand von Entstehungs- und Wirkungsgeschichte zu würdigen.
Vielleicht, vielleicht auch nicht, möglicherweise
Die Unterschiede der Ansätze beider Autoren sind jedoch, sozusagen bei paralleler Lektüre der Werke, unübersehbar: Während Günther plausibel darlegt, warum an Shakespeares Autorschaft keinerlei Zweifel besteht, belässt Gelfert, der vorsichtige Akademiker, hier vieles im Konjunktiv, wägt ab und verwirft. Zwar stimmt er dahingehend mit Günther überein, dass Schulbildung zu Shakespeares Zeiten viel intensiver betrieben wurde – ein 14-Jähriger habe nach seinem Schulabschluss damals mehr gewusst als heutzutage ein Student nach dem Master-Abschluss –, aber "scheint", "wäre", "hätte" und "möglicherweise" finden sich in seiner Untersuchung sehr viel häufiger als in "Unser Shakespeare".
Um beim Bild des Globe zu bleiben: Während sich Günther/Gelfert an das jeweils unterschiedliche Publikum wenden, steht der dritte Autor sozusagen vor den Toren des Theaters und gibt den Besuchern einen ausführlichen Handzettel mit, der sie vorab über die Vorführung informiert.
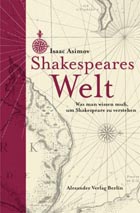 Isaac Asimov, besser bekannt als Science-Fiction-Autor, hat in seinem 1970 erschienenen und jetzt erstmals auf Deutsch erschienenen Buch "Shakespeares Welt. Was man wissen muss, um Shakespeare zu verstehen" eine ausführliche Interpretation jedes seiner Dramen geliefert. In die deutsche Fassung haben zwar nur zwölf Stücke Eingang gefunden, also ein knappes Drittel, aber auch so kommen bereits stolze 600 Seiten zusammen. "In der Erfindung möglicher Welten, die unsere bekannte Welt in neue Perspektiven rücken, liegt die Affinität [des Science-Fiction-Autors und Weltenerfinders Isaac Asimov] zu Shakespeare", schreibt Tobias Döring, Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft in der Einleitung.
Isaac Asimov, besser bekannt als Science-Fiction-Autor, hat in seinem 1970 erschienenen und jetzt erstmals auf Deutsch erschienenen Buch "Shakespeares Welt. Was man wissen muss, um Shakespeare zu verstehen" eine ausführliche Interpretation jedes seiner Dramen geliefert. In die deutsche Fassung haben zwar nur zwölf Stücke Eingang gefunden, also ein knappes Drittel, aber auch so kommen bereits stolze 600 Seiten zusammen. "In der Erfindung möglicher Welten, die unsere bekannte Welt in neue Perspektiven rücken, liegt die Affinität [des Science-Fiction-Autors und Weltenerfinders Isaac Asimov] zu Shakespeare", schreibt Tobias Döring, Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft in der Einleitung.
Asimovs Deutungsansätze sind erfrischend pragmatisch und von einer genialen Schlichtheit. Um etwa die Atmosphäre des "Sommernachtstraums" zu erklären, beginnt er damit, dass "einem Volksglauben zufolge extreme Hitze wahnsinnig" machen könne. Deshalb neige der Mensch an Mittsommer besonders dazu, sich fantastische Erlebnisse einzubilden. "Wenn Shakespeare das Drama also mit A Midsummer Night’s Dream‘ betitelt, dann beschreibt er es ganz bewusst als ein Stück blanker Phantasie."
Und so geht es munter weiter, von Komödie zu Tragödie zu Historienstück. Asimovs Interpretationen sind Populärwissenschaft im allerbesten Sinne. Nicht all seine Deutungen werden von Günther und Gelfert, wo sie dieselben Themenkreise besetzen, geteilt. So bleiben Reibungsflächen und Widersprüche – allein bei diesen drei Autoren; von den anderen paar Tausend ganz zu schweigen. Shakespeare ist mithin noch für weitere 450 Jahre gut für akademischen Streit. Möge das Publikum profitieren!
Hans-Dieter Gelfert
William Shakespeare in seiner Zeit,
C. H. Beck, München 2014, 471 Seiten, 26,95 Euro.
Frank Günther
Unser Shakespeare
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014, 335 Seiten, 14,90 Euro
Isaac Asimov
Shakespeares Welt. Was man wissen muß, um Shakespeare zu verstehen.
Mit einem Vorwort von Tobias Döring.
Aus dem amerikanischen Englisch von Anemone Bauer u. a.
Alexander Verlag, Berlin 2014, 601 Seiten, 34,90 Euro.
Noch ein lesenswertes, zudem bilderreiches Buch über Shakespeare hat Neil MacGregor verfasst und nachtkritik.de im Jubiläumsjahr besprochen: Shakespeares ruhelose Welt.
Auch besonders: Eine der Shakespeare-Figuren hat es jetzt zu einem so hilf- wie umfangreichen Nachschlagewerk gebracht: Hamlet. In dem von Peter W. Marx herausgegebenen Hamlet-Handbuch wird umfänglich und gründlich, oft mit überraschenden Details versehen über die Stoffgeschichte, die Deutungsprobleme und Lesarten, die Übersetzungen und Rezeptionsgeschichten des Dramas informiert (Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 2014, 563 S., 79,95 Euro).
mehr bücher
meldungen >
- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
neueste kommentare >
-
Woyzeck, Leipzig Perfektes Gesamtkunstwerk
-
Pygmalion, Berlin Beseelte Leiber
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Realität
-
RCE, Berlin Mehr als überzeugend
-
RCE, Berlin Geglückt
-
Pygmalion, DT Berlin Augenhöhe
-
Neue Leitung Darmstadt Fest oder frei?
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch
-
Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise


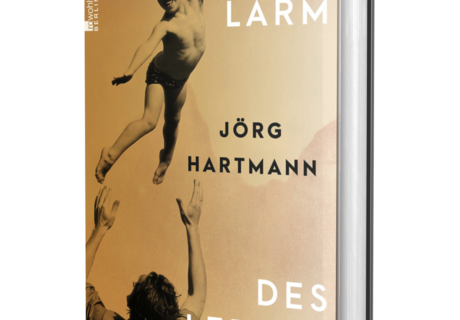
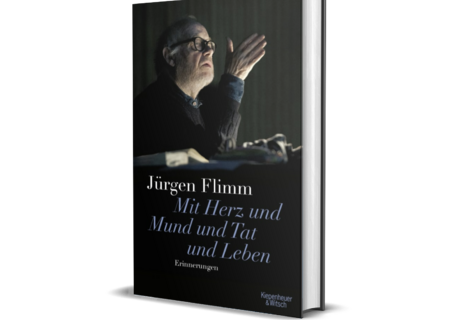
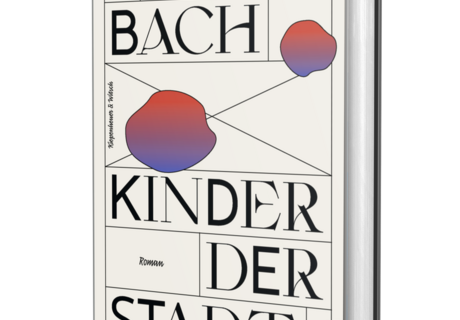
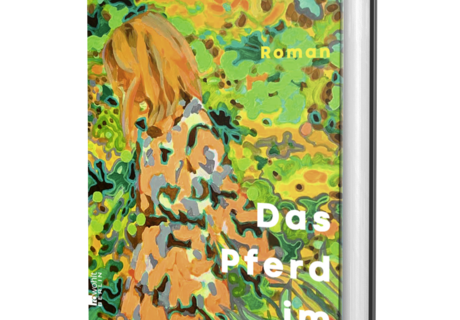
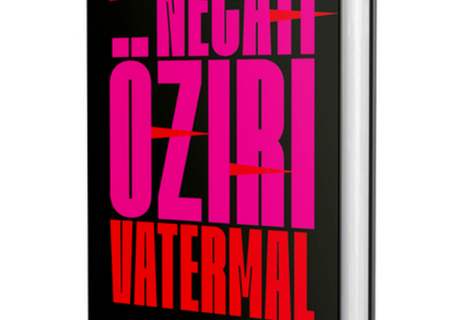






Shakespeare
Unter Elisabeths Granden glänztest auch
du, du pflegtest üppigen Brauch
gefältelte Krause, silbrige Seiden
Schenkel umhüllend, keilgleich der Bart
schienst du wie alle... so, in die kurze Mantelart
mochte der göttliche Donner sich kleiden.
Von allem Theaterlärm unnahbar weit
schobst du achtlos den Lorbeer beiseit
den dir zu flechtenden, trockenen Kranz
und verbargst auf ewig dein Riesengenie
in einer Maske, doch deiner Phantasie
weit hallende Echos verblieben uns ganz:
Venedigs Mohr hisst sein Trauerpanier
Falstaffs Haupt - einem Euter gleich, beklebt
mit ’nem Schnauzbart; der brüllende Lear...
Ihr Schöpfer weilt unter uns, er lebt -
nur auf ihn den Blick, in die Irre gelenkt
hast du den, hast dich der Welt entzogen
um deinen Namen, dein Bild uns betrogen
und sie in deiner geliebten Lethe ertränkt.
Ist doch wahr: ein Geldschneider unterschrieb
- gegen Bares - dein Werk, das jetzt nach ihm heißt
ein gewisser Will Shaxper, er spielte in „Hamlet“ den Geist
ein Säufer, dem sterbend die Zeit nicht blieb
den Teller Schweinskopfsülze zu verdauen...
Die Fregatte holt Luft, du gehst auf Reisen.
Italien sahst du. Singend rief eine Frauen-
stimme durch das geschmiedete Eisen
sie rief untern Balkon den Inglese, rank
vom gelben Zitronenmond sehnsuchtskrank
in den Gassen Veronas. Ich male mir
mit Vorliebe aus, wie irgendwann sich
Don Quichotes kauziger Schöpfer mit dir
unterhielt, humorig und wunderlich
nichtsahnend, am zufälligen Ort
eures Pferdewechsels - der Abend war
garantiert blau - Eimerklang, glasklar
vom Brunnen hinter dem Gasthof... Auf ein Wort
wen hast du geliebt? Verrat’s uns, in wessen Lebensbericht
wirst du flüchtig erwähnt? Zeigten dir nicht
Unzählige Nullen, wie Spurlegen geht?
Wie viele Namen allein bei Brantôme!
Enthüll dich, des jambischen Donners Phantom
hundertmündiger, unerdenklicher Poet!
Nein! Zur bestimmten Stunde - es rückt
der Gott dich, du fühlst es, aus deinem Sein -
ziehst du die Handschriften insgeheim ein:
Schamloses Weltmaul, nimmermehr drückt
dein Geschwätz meiner Größe sein Brandzeichen auf!
Und zur Gesichtslosigkeit erkoren
trotzt du der Jahrhunderte staubendem Lauf
wie die Unsterblichkeit selbst... und gingst lächelnd verloren.
1924
(Aus dem Russischen von Julia König und F.-P. Steckel)
FAZke und ZEIT-Geist gewidmet
Mann Brecht, jetzt wissen wir: du hattest nur Hunger
Nach Mutterbrüsten, wie wir
Den Promovierten glauben dürfen: GERMANISTEN.
Freilich ist es nicht recht wie du mitschreibst, aus dem Off
Sozusagen. Ich zum Beispiel erwerbe Gedichte von
Müller, Heiner. Fast siebzig
Gezahlt, bekommen zwanzig, der Rest von dir. – Du
Willst dich zur Ruhe nicht setzen
In Schaukelstühlen auf unseren Bühnen, schön
Von Tabak und Jahren. Für dich die die dunklen, die weißen
Für Frisch: Gerechtigkeit muss sein
Würdest du sagen und: INDENORKUS die weißen, na –
Ja, wir tun unser bestes gegen dich; mauern
WITH THECOMPLETEWORKS so gut es eben geht –
Meist geht es nicht.
Ich zum Beispiel kratze mit Mühe den oben
Genannten aus meinen Stücken HE IS MY WORST ANTAGONIST,
Verwende Schnitzer, rasiermesserscharf geschliffen und besser
Geeignet für die höhere Kunst der Herstellung von Violinen – Mann
Brecht, du mit dem listigen Grinsen – Nur William wird sich nicht
Totlachen können an uns: Daran stirbt man nicht AND
WRITING IS A GREAT DISCRETION…
D. Rust (1992)
Meine persönliche Vermutung ist hingegen, dass es sich durchaus um einen Getreidehändler gehandelt haben könnte, der – und zwar gerade weil er in seinem Umfeld eine Hochbegabung gewesen sein muss – einem Erfahrungsdruck ausgesetzt gewesen sein könnte, der ihn in die Dichtung gedrückt hat und aus seinem sozialen Umfeld herausgeschleudert hat, seine Biografie also gebrochen und in der Folge eine Lebensend-Verarmung bewirkt haben könnte... Müller hat gesagt – und gewusst warum – der Druck der Erfahrung treibt die Sprache in die Dichtung. Die Erfahrung mit den Adelsgebahren dürfte dann der Schauspieler gemacht und verarbeitet haben… Der umgekehrte Weg von "oben" nach "unten" scheint mir weniger wahrscheinlich, weil der soziale Druck da nicht so groß gewesen sein dürfte für eine Hochbegabung… Es würde mir sehr viel Freude machen, hierrüber mit Ihnen zu sprechen, der Austausch würde garantiert, hier weitergeführt, den Rahmen des Forums irgendwie sprengen und ich kann mir das in der Schriftform als Freizeitfreude einfach nicht leisten, bitte verzeihen Sie mir das. – MsfG -
Der Druck der Erfahrung treibt die Dichtung in die Sprache . . .
(zu 6.: "Der Druck der Erfahrung treibt die Sprache in die Dichtung.")
das ist hier zwar nicht der Ort -- und ich habe weder Zeit noch Lust -- diese Diskussion lange weiterzuführen. Eine Anmerkung und eine Frage aber doch.
Die Anmerkung: Ihr letzter Satz könnte genauso gut von irgendeinem Bardolator stammen. Diese weichgezeichneten und übersteigerten Beschwörungen des Shakespearschen Universalismus vereinigen die Autorenschaftsskeptiker und die Romantiker unter den Shakespeare-Forschern (die aber Gott sei Dank auch weit ausserhalb der ernstbenommenen Diskussionen ihr Unwesen treiben -- siehe Bloom, Harold). Ich kann mit dieser Auffassung von Literatur sehr wenig anfangen; auf das Theater bezogen, sogar noch weniger.
Die Frage: "es gibt Beispiele." So so. Aha. Welche denn bitte?
ich bin verblüfft, dass sie das handtuch über ihrer schulter gegen das viktorianische häubchen von delia bacon auf ihrem haupt eingetauscht haben.
die vielfach auf den prüfstand gestellten forschungserkenntnisse der letzten jahrzehnte ergeben nun wirklich beyond any reasonable doubt, dass im wesentlichen shakespeare die stücke geschrieben hat, die unter seinem namen firmieren. sie ergeben aber auch, dass ko-autorschaft in der elisabethanischen dramatik weiter verbreitet war als ohnehin gewusst oder vermutet, und an diesem punkt hat sich die "orthodoxie" zunächst durchaus handfest gegen die ergebnisse z.b. eines gary taylor gewehrt, der middletons mitwirkung etwa an "macbeth" nachgewiesen hat. mittlerweile ist dergleichen auch von der orthodoxie aber nolens volens anerkannt.
dass eine puritanische amerikanische lehrerin im amerika der mitte des 19. jahrhunderts wie delia bacon sich nicht vorstellen kann, dass ein handschuhmacherssohn "hamlet" geschrieben haben soll, kann ich mir vorstellen. aber warum sie, der sie mir lange ein leuchtturm der aufklärung waren?
sind sie enttäuscht, dass der gute will in seinen letzten jahren nur mehr immobilien verschoben hat? mit dergleichem schock musste ich schon in meiner jugend klarkommen, als ich herausfand, dass der grosse wilde rimbaud zum waffenhändler mutierte... dennoch zieht dessen autorschaft niemand in frage...
und: alle alternativ genannten potentiellen "eigentlichen" autoren sind samt und sonders ihrerseits engländer. nationalismus kann also kaum teil der debatte sein. wenn denn de vere earl of oxford oder francis bacon (von denen es ja texte gibt. haben sie da mal reingelesen?) auch nur halbwegs plausibel zu argumentieren wären: glauben sie als alter materialist nicht, dass die tourismusbüros von oxford respektive london sich mühelos gegen stratford (kaum halb so gross wie das niederbayrische städtchen straubing) durchsetzen würden?
ich kannte holger syme vor diesem scharmützel nicht. (er hat die besseren argumente als sie, lieber steckel.) jetzt lese ich jedoch gerade mit grossem gewinn und vergnügen sein buch "theatre and testimony in shakespeare's england" (darin besonders den beitrag über das "wintermärchen", das ich demnächst inszeniere). dafür danke!
und "im Hinblick auf das Theater darf ich Ihnen sagen, dass" BEI MIR "auf einer Probe ... der Autor, der den Proben zu einem Text von Shakespeare seinen Besuch abstattet" ... "dem Mann aus Stratford" UNBEDINGT "ähnlich" sieht.
mir erscheint er immer mit ohrring. so, wie er im sogenannten chandos - portrait in der national portrait gallery zu sehen ist, das höchstwahrscheinlich irgendwann um das jahr 1610 von einem aufstrebenden jungen schauspieler (!) namens joseph taylor gemalt wurde, den shakespeare als sein "intimate friend" in die darstellung des hamlet in der nachfolge von richard burbage initiiert hat. (das können sie in der letzten ausgabe der TLS in einem grossartigen essay der nicht weniger grossartigen katherine duncan-jones nachlesen...)
haben sie das bild schon mal im original gesehen? mir beantwortet es jedenfalls in seiner hinreissend sinnlichen widersprüchlichkeit so ziemlich alle fragen...
yours,
g.w.