Kolumne: Als ob! - Über die Interventionen der Kritik-Kritiker
"Your time is over, Darling!"
3. September 2022. Regisseur und Schauspieler Benny Claessens beschimpft öffentlich eine Kritikerin. Das Kunstfest Weimar droht einem Rezensenten sogar mit dem Anwalt. Hinter solchen Angriffen auf die Kritik steckt mehr als verletzte Eitelkeit. Die Kunst selbst steht auf dem Spiel.
Von Michael Wolf
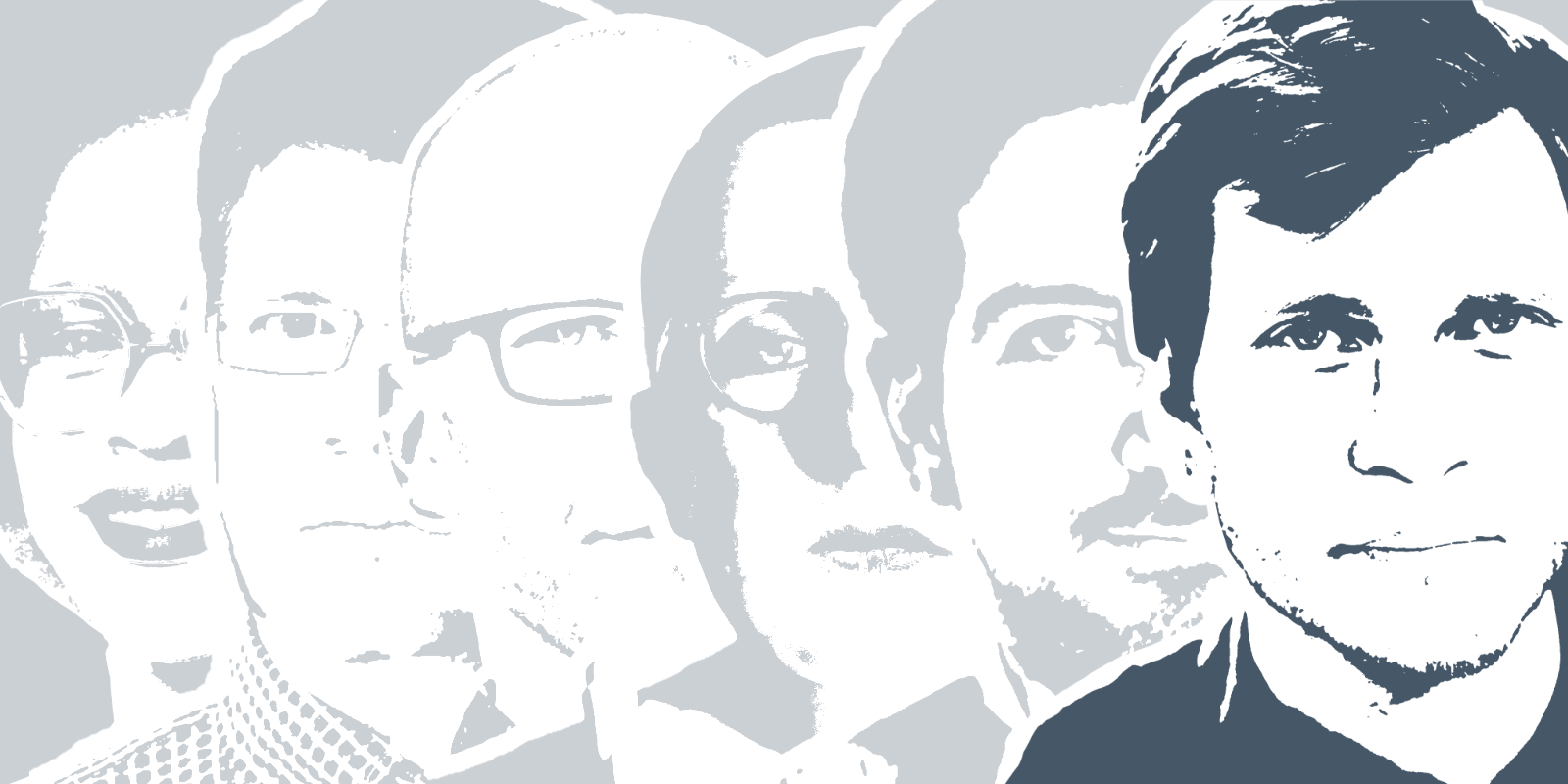
3. September 2022. Am Mittwoch sorgte das Kunstfest Weimar für Kopfschütteln in den Redaktionen. Die Pressestelle schickte eine Gegendarstellung zur Kritik eines Journalisten des Deutschlandfunks. In der Goethe-Stadt war man pikiert darüber, dass mein Kollege Thilo Sauer die Produktion Animate als "nicht 'state of the art'" bezeichnet hatte – für das Festival nichts anderes als eine "Fehldarstellung". Am Ende einer ausführlichen Erläuterung stand für Regisseur Chris Salter zweifelsfrei fest, dass der Einsatz der verwendeten Technologien "nicht nur technologisch, sondern auch künstlerisch auf dem neuesten Stand der Technik" sei. Um dieser Tatsache noch etwas mehr Gewicht zu verleihen, kündigten die Künstler an, rechtliche Schritte gegen den Deutschlandfunk zu prüfen.
Ich dachte, damit wäre die Peinlichkeit der Woche gefunden, doch dann schickte der Schauspieler und Regisseur Benny Claessens am Donnerstag einen Social Media Post ab. Er ging darin recht ruppig Nachtkritikerin Valeria Heintges an, die zuvor Claessens' Inszenierung White Flag besprochen hatte. Und das offenbar nicht im Sinne des Künstlers, der die Rezension "reactionary", "pretty dumb" und "uninspired" schalt und auch vor persönlichen Beleidigungen der Autorin nicht zurückschreckte. "I hope I get the help you need" stand da, womit der Schauspieler des Jahres 2018 wohl zum Ausdruck bringen wollte, dass mit meiner Kollegin etwas nicht stimme. Dass wiederum mit diesem Post etwas im Argen lag, in dem es weiter hieß: "Your time is over Darling", dürfte auch Claessens jemand nahegelegt haben, weshalb er bald darauf gelöscht wurde.
"Scheiße am Ärmel"
Man könnte über diese Eskapaden peinlich berührt den Mantel des Schweigens hüllen, läge in ihnen nicht auch etwas Erkenntnispotenzial verborgen. Denn in letzter Zeit häufen sich die Misstrauensvoten der Kunst gegenüber der Kritik. Vor einem Jahr beschwerte sich die Hamburger Intendantin Karin Beier über schlecht informierte Kritiker, deren Texte wie "Scheiße am Ärmel" klebten. Beier selbst versicherte, niemals Rezensionen zu lesen, fühlt sich aber offenbar dennoch von ihnen verfolgt.
Im Mai dann überboten sich Matthias Lilienthal und Amelie Deuflhard in einem Abgesang auf die Theaterkritik. Diese liege, so darf man Lilienthal verstehen, strukturell und ökonomisch zwar schon in den letzten Zügen, "(g)leichzeitig wird aber dem Kulturjournalismus noch der Wert zugeschrieben, den er vor einem Jahrhundert hatte." Deuflhard ärgerte sich über die Zuschauer, die tatsächlich glauben, was in der FAZ steht, und freute sich über die Segnungen der sozialen Medien, durch die man der Kritik endlich widersprechen könne.
All diese Interventionen zeichnen sich durch eine erstaunliche Ambivalenz aus. Die Kritik wird einerseits als wirtschaftlich schwach aufgestellt beschrieben, als qualitativ minderwertig oder politisch rückständig, als obsolet und uninformiert, was insgesamt dafür sprechen dürfte, dass sich keine Sorgen machen müsste, wer die Kritik als Gegnerin versteht. Aber andererseits ist da auch dieses merkliche Unbehagen zu erkennen, womöglich gar Furcht.
Im aufklärerischen Ton gegen die "Kunstreligiosität"
Auch die jüngste Unruhe um das Theatertreffen fügt sich hier gut ein. Im schon genannten Gespräch wünschten sich Lilienthal und Deuflhard eine Internationalisierung des Festivals und eine Abschaffung der Kritiker-Jury (mehr dazu hier im nachtkritik-Kommentar zur neuen Theatertreffen-Leitung). Kurz darauf kamen Gerüchte auf, dass sich genau diese Pläne mit denen des neuen Festspiele-Intendanten Matthias Pees decken könnten (Pees selbst dazu hier im nachtkritik-Interview). Nun ist das Auswahlverfahren der Markenkern des Theatertreffens. An diesem zu rühren, würde faktisch bedeuten, es abzuschaffen. Man könnte meinen, die Kritik ist den Kuratoren ein solcher Dorn im Auge, dass sie, um sie endlich loszuwerden, leichthin bereit wären, das bedeutendste Theaterfestival Deutschlands zu opfern.
Dieser Eifer irritiert gerade viele, ergibt aber durchaus Sinn, wenn man die Debatte in einen kunsthistorischen Kontext stellt. Man kann die Kritik-Kritiker als Agenten einer Entwicklung verstehen, die der Theoretiker Wolfgang Ullrich in seinen letzten Büchern beschrieb und befördert. Ullrich sieht die aus der Romantik stammende Vorstellung der Kunstautonomie an ihrem Ende angekommen, also die Idee, Kunst diene keinem ihr äußeren Zweck. Im aufklärerischen Ton schreibt er gegen diese "Kunstreligiosität" und jene an, die noch an Begriffen wie Aura, Transzendenz oder dem des Rätselcharakters eines Werks festhalten. Wirklich zeitgenössische Kunst habe sich längst davon emanzipiert und nähere sich stattdessen dem Aktivismus, der Konsumkultur oder dem Fantum an. Es geht also nicht mehr um Schönheit, Wahrhaftigkeit oder das Ereignis, sondern um Botschaften, um Design, um Gemeinschaft und Partizipation.
Kunst, die keine mehr sein will
Soziale Medien, die Erosion von Institutionen und die Globalisierung befördern diesen Prozess. Der auf Bühnen und Säle angewiesene Theaterbetrieb hinkt ihm noch hinterher. Jeder Schritt hin zu einer Internationalisierung lässt sich auch als Versuch verstehen, endlich Strecke zu machen. Weg von einem sprachgemeinschaftlichen oder gar nationalen Kanon, von Rezeptionsgeschichten und klassischer Bildung, hin zu einer Kunst, die nichts mehr einfordert, die überhaupt keine Ansprüche mehr formuliert, weil sie selbst gar keine Kunst mehr sein will, sondern lieber Produkt, Spielzeug oder Statement. Es ist kein Wunder, dass vor allem Größen der Freien Szene voranschreiten. Sie stehen der Bildenden Kunst und ihrem Diskurs viel näher als Stadttheater-Intendanten, zudem gehören internationale Kooperationen zu ihrem täglichen Geschäft.
Zurück zur Kritik: Eine Bühnenkunst, die sich restlos von ihrer ästhetischen Autonomie verabschiedet, würde natürlich keine solche mehr benötigen oder die Künstler könnten sie selbst besorgen (mehr zur Debatte um Kritik und postautonome Kunst hier im nachtkritik-Essay). Ihr methodisches Repertoire wäre nicht mehr gefragt, ihre Außenperspektive würde sogar stören, da sich nunmehr Produktion und Rezeption in Netzwerken aus Fans, Konsumenten und Aktivisten in schönster Harmonie auflösten. Die Vorstellung, jemand Unbeteiligtes könnte hier über so etwas wie Qualität befinden, wäre schlicht unanständig.
Herbeigesehnte Befreiung
Doch so weit ist es noch nicht. Und solange Kritiker noch ins Theater gehen in der Erwartung, dort würden sie auf Kunst treffen, stabilisieren sie eine vermeintlich überkommene Ästhetik. Gerade deshalb ist die Feindlichkeit der Kritik-Kritiker sehr nachvollziehbar. Sie sehen durch sie eine herbeigesehnte Befreiung gehemmt. Wenn die klassische Kritik noch da ist, kann man nicht so tun, als wäre die alte Kunst längst passé.
Vielleicht stimmt es also gar nicht, was eigentlich doch als ausgemacht galt: Dass die besten Zeiten der Kritik Jahrzehnte zurückliegen, dass sie kaum noch von Interesse ist und keine Funktion mehr ausübt. Vielleicht bewahrt sie im Gegenteil gerade die Kunst vor ihrem drohenden Ende. Ob das eine gute Tat ist oder eine schlechte, darüber mag man sich streiten. Mir gefällt zumindest der Gedanke, dass dieser Tage jede kleine Rezension, die ein Ressortleiter lustlos in die rechte Zeitungsspalte quetscht, von Bedeutung ist. Und zwar einfach dadurch, dass da jemand in ein Theater hinein- und später wieder herausgegangen ist, um das, was er in der Zwischenzeit erlebt hat, in die Höhe zu loben oder in der Luft zu zerreißen, in jedem Falle aber – als Kunst – zu beschreiben.

Kolumne: Als ob!
Michael Wolf
Michael Wolf hat Medienwissenschaft und Literarisches Schreiben in Potsdam, Hildesheim und Wien studiert. Er ist freier Literatur- und Theaterkritiker und gehört seit 2016 der Redaktion von nachtkritik.de an.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.
mehr Kolumnen
neueste kommentare >
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Die raren absoluten Ausnahmen
-
Neue Leitung Darmstadt Lange Zusammenarbeit
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Zwei andere Akzente
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Zweifel
-
Neue Leitung Darmstadt Mehr als ein Versprechen!
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Freie Radikale
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Die Wagnisse
-
Neue Leitung Darmstadt Stabil geblieben
-
Deutschlandmärchen, Berlin Musical mit großen Gefühlen
-
Neue Leitung Darmstadt Saustark ohne Label











Dem längst vorangegangen - und ironischerweise von Teilen der Kritik eine Zeitlang unterstützt - ist eine mitunter verächtliche Haltung gegenüber dem Publikum. Letzteres kommt nun der Ausladung zunehmend nach ("Publikumsschwund"), weil es seltsamerweise nicht einfach bereit ist, die vorgesetzten Programme devot zu akzeptieren und dafür auch noch zu zahlen und ihre Lebenszeit zu verschenken.
Die Ablehnung professioneller Kritik ist jedoch ein Meilenstein der Selbstmarginalisierung: hier wird gegen Meinungsmultiplikatoren vorgegangen, die dem Theater noch jenen Raum in der - nicht nur publizistischen - Öffentlichkeit verschaffen, der längst kostbar geworden ist. Zudem bietet die Kritik Grundlagen für politische Entscheidungsträger, die Intendanzen besetzen müssen.
Sich in einer Zeit, wo weitere finanzielle Einschnitte in den öffentlichen Haushalten und verstärkt privates Sparen wahrscheinlich sind, so zu verhalten, ist nicht besonders intelligent. Theater ohne Publikum und ohne Kritik findet nicht mehr statt und ist auch kein Theater mehr und wird in weiterer Folge auch nicht mehr subventioniert werden.
Übrigens: Wenn manche Leute statt Stadttheater lieber bildende Kunst spielen wollen, dann wünsche ich schon jetzt viel Vergnügen. Zeitgenössische Kunst wird von privaten Sammlern, großen Galeristen, einflussreichen Messen und ein paar Kuratoren bestimmt, die öffentliche Hand hat da nichts zu melden. Die USA sind ein gutes Beispiel: tolle Kunstszene mit viel Geld und grandiosen Ausstellungsmöglichkeiten. Für Theater interessieren sich vergleichsweise wenige, die Jobs sind überschaubar und prekär, niemand braucht Intendanten und niemand kennt die Namen der Regisseure, öffentliche Subventionen sind praktisch nicht vorhanden, dafür entscheiden Mäzene und Sponsoren, was gezeigt wird. Will das deutsche Theater diese Situation ernsthaft haben? Sie werden sich an die gute alte Stadttheaterzeit mit Tränen in den Augen erinnern.
Ich kann prima mit KrikterkerInnen leben, solange die auch Theater kritisieren, indem sie Vergleiche ziehen, Widersprüche und Differenzen zwischen einzelnen Theaterkunstauffassungen beschreiben und den verschiedensten beschriebenen Perspektiven eine moralische Gleichberechtigung zubilligen. Wenn sie, was das anlangt, die eine oder andere Moral hinter einer Interpretation persönlich bevorzugen, sollen sie Ichbevorzugejedoch sagen.
Ich halte es für selbstmörderisch weil sowohl KünlerInnen als auch Publikum total abtörnend, wenn Kritiker denken, sie müssen selber kreativ werden und ihre untertourte Kreativität in Form von Kreierung von Debatten unter Beweis stellen. Wenn sie wie Trüffelschweine existente Debatten aufspüren und ihnen eine schreib-Bühne bereiten - prima, die erfunden schrammen leider immer am - meist im Grunde politökonomischen - Problem vorbei.
Ich bin für das Prozedere der Kritikerauswahl für das Theatertreffen, weil es so angedacht war, entstanden ist und lange Bestand hatte. Zur Aufbesserung der Kritik-Qualität würde ich keineswegs das xte Kuratoriums-Festival daraus machen, sondern unbedingt der Profi-KritikerInnen-Jury eine Laien-KritikerInnen-Jury paritätisch gegenüber stellen. Da können ALLE nur davon lernen.
Es ist doch so:
80-90 Prozent der Theateraufführungen sind mittelmäßig bis schlecht. Das gilt nicht nur für das Theater, sondern auch für den Literatur- und Kinobetrieb. Viele Regisseure verstehen häufig die Komplexität und den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Werke nicht vollständig, weil sie sich unter Zeitdruck mit dem Werk befassen und etwas auf die Bühne bringen müssen. Sie suchen sich dann den ein oder anderen interessanten Aspekt heraus und meinen, diesen überdeutlich in die Jetztzeit transferieren zu müssen. Es wird mit winkendem Zaunpfahl darauf hingewiesen, was uns das Stück „heute noch sagt“. Und dann kommt noch weiterer SchnickSchnack wie Video etc. dazu.
Solche Inszenierungen will man möglichst nicht sehen, denn eine schlechte Theaterinszenierung kann einen für 1-2 Tage richtig runterziehen. Um dies zu vermeiden, spielt die Kritik eine wichtige Rolle. Natürlich ist der ein oder andere Kritiker etwas selbstverliebt, will seinen Fundus an Fremdwörtern zum besten geben und mit besonderen Sprachbildern seinen literarischen Idolen nacheifern. Das ist mitunter anstrengend und nicht immer am Leser orientiert; manchmal erscheint die Kritik auch unnötig verletzend, weil wohl auch mal persönliche Animositäten mit einfließen, die eigentlich nicht sein sollten. Gleichwohl bietet die Kritik der Qualitätsmedien eine gute Orientierung. Ich kann mich jedenfalls an keine in mehreren Qualitätsmedien gelobte Theaterinszenierung erinnern, die ich gänzlich missraten fand.
Fazit: Theaterkritik gab es und wird es weiterhin geben. Denn es gibt eine nicht geringe Anzahl von Theaterästheten, die nicht ins Theater gehen würden, wenn sie nicht das verlässliche Gefühl hätten, eine gute Inszenierung sehen zu können. Und um diese Menschen ins Theater zu bekommen, bedarf es der Theaterkritik. Eigentlich ganz simpel.
alle, die da heute noch sind, haben einfach nicht früh genug den Absprung geschafft und sind irgendwie verwickelt in dieses rückständige Anerkennungssystem. Das ist alles. Sonst nichts.
Klar, ich will, wie Sie und jede/r Andere auch, möglichst gutes Theater sehen. Anders als Ihnen war mir da aber die Kritik in den letzten Jahren in keiner Weise hilfreich. Das in der Kritik beschriebene deckt sich ganz häufig nicht mit meinem Seheindruck der Inszenierung. Die Anforderungen und Kriterien von Kritik und "Normalpublikum" scheinen mir da immer mehr auseinander zu driften.
Die Kritik scheint oft von möglichst verkopftem, abgehobenem, überintellektuellem Theater begeistert, das ich leider häufig als elitär, unzugänglich und langweilig empfinde. Und anders als Sie, saß ich schon ganz oft in Inszenierungen, die von der Kritik in mehreren seriösen Medien über alle Maßen gelobt und gefeiert wurden, und war von dem Gezeigten tief gelangweilt und enttäuscht.
Ein viel verlässlicherer Indikator scheint mir da die persönliche Empfehlung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, damit habe ich in den letzten Jahren deutlich bessere Erfahrungen gemacht, als mit einer Orientierung an einer oft abgehobenen Theaterkritik. Hinzu kommt noch die von Ihnen bereits erwähnte überkandidelte Sprache, die oft exzessive Selbstdarstellung des Kritikers oder der Kritikerin, und die persönlichen Animositäten. Das in Verbindung mit der großen Diskrepanz zwischen den abgehobenen Seh-Wünschen einer professionellen Kritik-Blase und denen eines "normalen" Publikums macht Theaterkritik für mich wenig hilfreich. Eigentlich ganz simpel. Leider.
Aber es scheint ja so ziemlich jede Grenze eingerissen zu haben die man von einer sachlichen Auseinandersetzung mit etwas erhofft.
Wenn Kritik in so einem Maße persönlich wird statt sich mit der Sache auseinanderzusetzen und nur die eigene Befindlichkeit der Maßstab ist dann verfehlt sie mit großer Sicherheit ihr Ziel.
Als Schauspieler weiß ich wie verletzend das sein kann. Raten sie mal woher....
____________
(Lieber Christian Sunkel, der Text von Valeria Heintges ist eine nachtkritik und hier nachzulesen:
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=21351:white-flag&catid=186&Itemid=40
In der Kolumne ist der Text auch direkt verlinkt, unter "White Flag". Aus unserer Sicht bleibt unsere Kritikerin stets auf der Ebene der Inszenierung, von der sie als Sache nicht überzeugt ist. Niemand wird als Person beleidigt, persönlich ist der Text nur insofern als Valeria Heintges ihre eigenen Seheindrücke und Erlebnisse beschreibt. Aber lesen Sie selbst, vielleicht nehmen Sie die Kritik anders wahr?
Herzliche Grüße aus der Redaktion, E. Philipp)
Und ich glaube, dass die Kritik hier nur stellvertretend als Prügelknabe benutzt wird, weil die eigene Position in der Gesellschaft zunehmend als marginal und irrelevant empfunden wird.
Auf den Gedanken, dass diese Sachlage sich ohne Kritik eher verschlimmert als verbessert, kommen diese Leute seltsamerweise nicht (vermutlich weil, wie von mir oben angedeutet, längst der Rückzug in die Bubble stattgefunden hat, wo man es sich im Safe Space bequem und widerspruchslos eingerichtet hat). Der Publikumsschwund etwa verbessert sich wahrscheinlich nicht, wenn keine Kritik mehr stattfindet und nur noch mit Buzzwords gewürzte PR-Texte im Umlauf sind.
Ich fand seine Dlf-Kritik - nachdem ich das "Stück" gesehen habe - noch ausgesprochen wohlwollend.
--------------------------
Werte*r Biene,
wir kopieren Ihnen die Erklärung des Kunstfests Weimar gerne hier unter ihren Beitrag.
Herzliche Grüße aus der Redaktion, Esther Slevogt
____
Pressemitteilung / Gegendarstellung
31. August 2022
Der Theaterjournalist Thilo Sauer hat in seiner Besprechung des Enhanced Reality-Parcours folgende Äußerungen getätigt: „Die virtuelle Realität ist noch in der Erprobungsphase und weit entfernt von Perfektion – dennoch ist schon mehr möglich. ANIMATE ist sicherlich nicht `state of the art`.“ Dieses Urteil vertritt Herr Sauer ohne Angabe von Gründen oder weiteren Erläuterungen. Da es sich nicht um eine persönliche Meinungsäußerung handelt, sondern um Tatsachenbehauptung, die auf den aktuellen Stand der technologischen Entwicklung Bezug nimmt, unterliegt diese Äußerung der Überprüfbarkeit.
Das Kunstfest Weimar als Koproduzent des Projektes ist daran interessiert, dass das Ansehen und der Ruf der Künstler, mit denen es zusammenarbeitet, gewahrt bleiben und nicht durch Fehldarstellung in der Presse geschädigt werden. Deshalb verlautbart das Kunstfest Weimar gerne folgende Mitteilung / Gegendarstellung von Professor Chris Salter und der mit ihm zusammenarbeitenden Experten von Disk e.V. Berlin mit der Bitte um Veröffentlichung:
„Die Neuartigkeit des Projektes ist übrigens schon „handgreiflich“ erfahrbar: Wenn derzeit Augmented Reality im Theater oder in der bildenden Kunst eingesetzt wird, werden üblicherweise Smartphones und Tablets verwendet, um digitale Informationen in reale Szenen einzubetten und zu überlagern. Dies aber ist bei ANIMATE gerade nicht der Fall. Für ANIMATE wird stattdessen ein VR-Headset verwendet, dass sowohl VR- wie AR-fähig ist. Dadurch wird der Unterschied deutlich zwischen dem "Eintauchen" in eine computergenerierte Welt (Virtual Reality, in der es irrelevant ist, was in der realen physischen Welt geschieht) und dem Aufenthalt in einer realen Welt, die durch digital erzeugte Objekte erweitert wird (Augmented Reality). Die Installation ANIMATE macht erfahrbar, welche tatsächlichen Unterschied in der Wahrnehmung, Ästhetik und Erfahrung zwischen den beiden unterschiedlichen Technologien bestehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ANIMATE auch einer gewissen, vom Publikum erwarteten VR-Ästhetik (die sich seit den späten 1980er Jahren etabliert hat) einer plastischen, körperlosen, individuellen, computergenerierten Welt NICHT entspricht.“
Nach Kenntnis des Multimedia-Künstlers und Regisseurs Chris Salter, der diese Technologien aktiv erforscht, gab es noch nie eine Theaterproduktion in der Größenordnung von ANIMATE, bei der am Körper getragene, videobasierte "Passthrough"-Augmented Reality verwendet wurde. Die durch diese Brillen erzeugte optische Darstellung zeichnet sich dadurch aus, dass der Zuschauer das Gefühl hat, „durch“ die um ihn herumprojizierten Objekte zu laufen. Im Fall von "Animate" ist das der Steinregen am Schluss. Wearable AR (tragbare Augmented Reality-Brillen) steckt gemeinhin immer noch in den Kinderschuhen und „leidet“ an geringer Auflösung, kleinem Sichtfeld, teurer, zerbrechlicher Hardware und geringer Akkulaufzeit. Chris Salter schließt: „Der Einsatz spezieller Augmented-Reality-Technologien, wie sie in ANIMATE zum Einsatz kommen, ist daher nicht nur technologisch, sondern auch künstlerisch auf dem neuesten Stand der Technik.“
Journalist Thilo Sauer entgegnete in Abstimmung mit der Redaktion von „Kultur heute“ in einer Stellungnahme zu der Gegendarstellung des Kunstfest: "Bei dem Beitrag vom 27. September 2022 handelt es sich eine Rezension mit starken Fokus auf mein Erlebnis. Insofern ist auch die Bewertung, dass "Animate" "nicht State of the Art" sei, das Resümee eines persönlichen Eindrucks, nicht jedoch eine Tatsachenbehauptung.“ Die Künstler behalten sich nach Prüfung ggf. weitere rechtliche Schritte vor.
KUNSTFEST WEIMAR
Ich stelle mir gerade vor, der berühmte Avantgarde-Koch Ferran Adrià hätte auf kritische Stimmen so reagiert, seine Küche betreffende ablehnende Meinungen als Tatsachenbehauptungen etikettiert, daraufhin mit Gegendarstellungen gekontert und sich rechtliche Schritte vorbehalten ... Die Welt hätte ihn nicht mehr ernst genommen, sondern ihn ausgelacht. Kritik muss man eben gefälligst aushalten können, andernfalls möge man sich einen Beruf außerhalb jeglichen Rampenlichts und jeglicher Medienberichterstattung suchen. Genau darum übrigens wurde und ist Adrià ein großer Künstler: weil er sich souverän und großzügig verhält.
Warnung an alle Kritiker*innen: Vorsicht bei der Formulierung "state of the art". Sie verlassen den Meinungsbereich, der state of the art ist jetzt überprüfbar! Gehen Sie nicht über Los, gehen Sie direkt ins Gefängnis! Hahahahahaha! (Kunstfest, denk' noch mal nach! Könnte sein, dass ihr im Irrtum seid …)
Geht es vielleicht auch ein paar Nummer kleiner? Die Kritik an der Theaterkritik von einigen deutschen Theatermacher*innen mit Trump und Putin gleichzusetzen empfinde ich als außerst vermessen und unpassend. In meiner Meinung verhöhnen Sie damit auf zynische Weise die zahlreichen Opfer unter den Journalist*innen, die gerade in Russland um Ihr Leben, Ihre Freiheit und die Ihrer Familien fürchten müssen. Auch in den USA wurden und werden Reporter*innen immer wieder Opfer von digitaler und realer Gewalt. Das hat absolut keine Gemeinsamkeit mit der Situation der Theaterpresse in unserem Land. In meiner Einschätzung machen Sie hier einen äußerst unpassenden und gänzlich unangemessenen und deplazierten Vergleich.
Ja, ich finde "Kritik ist wie Scheiße am Ärmel" et al. in einer Demokratie diskursfähig. Zum Glück. Ich finde diese Aussage von Karin Beier zwar geschmacklos, dünnhäutig, unklug, vereinfachend, dreist, kleinkariert, pubertär, würdelos und und und. Aber zum Glück diskursfähig.
Denn genau darin liegt der Unterschied zu der von Ihnen nun zum zweiten Mal in meiner Sicht verharmlosten russischen Diktatur. Dort könne vergleichbare Äußerungen nämlich zu Gefängnis, Folter und Tod führen.
Ihren wiederholten Vergleich dazu ("Putin wächst auf dem Nährboden von dummer und geschmackloser Kritik an der Theaterkritik"), der in meinen Augen eben zynisch, naiv und die Opfer herabwürdigend ist, finde ich immer noch unfasslich deplaziert. Ich finde es aber natürlich trotzdem richtig, dass Sie Ihre in meinen Augen die Opfer von echten Diktaturen brutal und zynisch verhöhnenden Vergleich ohne die Angst irgendwelcher Repressalien öffentlich äußern können. Zum Glück können Sie das tun! Zum Glück! So wie ich es eben auch richtig finde, dass Karin Beier das Recht hat, Theaterkritik als "Scheiße am Ärmel" bezeichnen zu dürfen, auch wenn ich diese Ansicht nicht teile.
Aber lassen wir die weitere Diskussion, da kommen wir offensichtlich nicht zusammen in unserer unterschiedlichen Einschätzung von Repressalien und vom Leid von Opfern in der russischen Diktatur.
Im übrigen denke ich, dass die Darlegung einer kritik- und medienfeindlichen Haltung mit Vergleichen angereichert werden darf. Die Behauptung, dadurch würden Opfer "verhöhnt" werden, erscheint mir nicht sehr logisch. Die hier gemeinten Opfer - nämlich von Repressalien betroffene Journalisten - sind Opfer von unterdrückter oder eingeschränkter Freiheit. Freiheit wiederum verlangt freie Debatten. Freie Debatten verhöhnen niemals Opfer, die für - unterdrückte - Freiheit stehen. Im Gegenteil, diese Freiheit beginnt erst verlorenzugehen, wenn versucht wird, die Meinungsäußerungsfreiheit anderer Debattenteilnehmer ohne Not - hier haben alle zivilisiert diskutiert, niemand wurde beleidigt, keine gesetzlichen Normen wurden verletzt - einzuengen. Und ab einem gewissen Moment erscheint auch die wiederholte Verwendung des Wortes "zynisch" selbst nur noch zynisch. Weil die Einschränkung von Freiheit niemals die Opfer von Freiheitseinschränkung ehren kann, sondern sie desavouiert, mögen auch noch so viele scheinbar moralische Argumente angeführt werden, um dieses Vorgehen zu untermauern. Genau darum geht es übrigens in der Debatte an sich: um den Versuch der scheinbar objektiv begründeten, tatsächlich jedoch von höchstpersönlichen Präferenzen motivierten und von keinerlei rechtlicher Grundlage gedeckten Freiheitseinschränkung betreffend das Handeln anderer Individuen.
Im Podcast Gespräch hätte ich mir da mehr Gedanken über die Technik und Möglichkeiten von Kritiken gewünscht, das latente Abdriften in den Diskurs Performance vs. Narration hat leider ein durchaus interessantes Thema doch reichlich verwässert.